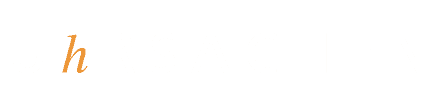Unsere Herzen schlagen mit 28’800 Halbschwingungen pro Stunde und in unseren Adern fliesst Möbius 9010 (Uhrenöl zur Schmierung der Hemmung). Wir sind infiziert mit dem Uhrenvirus. Doch wollen wir uns gar nicht dagegen wehren, sondern uns unserer Leidenschaft, der Uhrmacherei, hingeben. Unsere Herzen schlagen mit 28’800 Halbschwingungen pro Stunde und in unseren Adern fliesst Möbius 9010 (Uhrenöl zur Schmierung der Hemmung).

Kommen Sie mit uns an die Geneva Watch Days 2024!
05.09.2024Dominik Maegli nimmt Sie in diesem Video mit an die diesjährigen Geneva Watch Days. Schauen Sie sich das Video an und folgen Sie uns somit zu FORTIS, ARMIN STROM, LOUIS ERARD, ULYSSE NARDIN sowie weiteren Marken wie #BREITLING, #CZAPEK, #AMIDA, #ORIS, #RAKETA und deren spannenden Neuheiten!!
Introtext: Wir sind an den GENEVA WATCH DAYS in Genf. Das ist der Anlass, an dem sich die Uhrenbranche nach den Sommerferien trifft, um die Neuheiten für die zweite Jahreshälfte zu präsentieren. Die Uhrenmarken präsentieren sich hier in ihren eigenen Boutiquen in der Stadt, in Hotels oder anderen Lokalitäten ihrer Wahl. Es ist ein ungezwungener Anlass, an dem die Produkte aber auch die Menschen dahinter im Fokus stehen und somit ein wunderbarer Rahmen bietet, um sich auszutauschen und gemeinsam Kontakte zu pflegen. Zusammen wollen wir uns nun auf den Weg durch die Stadt machen, um gemeinsam die spannenden Neuheiten zu entdecken und die dafür verantwortlichen Leute zu treffen.
Das Video wurde vollumfänglich von unserem Mitarbeiter aus Solothurn, FIlip Jovanovic gestaltet- vielen Dank dafür!

Grönograaf – wenn sich die horological brothers selber übertreffen
14.12.2023INDEPENDENT WATCHMAKERS
«The Horological Brothers» wie sich die beiden Brüder Tim und Bart Grönefeld nennen, haben mit dem Grönograaf zu einem neuen Paukenschlag ausgeholt. Sie haben die verbreitetste Komplikation einer mechanischen Armbanduhr, den Chronografen, neu erdacht. Die Kunstwerke von Grönefeld, der Ausdruck Zeitmesser wäre hierfür zu banal, zählen weifelsohne zu den exquisitesten Kreationen im Kreise der unabhängigen Haute Horlogerie. Und da sich diese pure Faszination kaum mit ein paar Worten wiedergeben lässt, laden wir Sie herzlich zu uns nach Bern ein, um gemeinsam mehr über das Schaffen dieser beiden holländischen Tausendsassas zu entdecken.

Qlocktwo Moon – die andere Mondphasenanzeige
03.11.2023Der Mond hat eine tiefe kulturelle, mythologische und somit auch künstlerische Bedeutung und ist seit jeher eine inspirierende Quelle für Menschen auf der ganzen Welt.
Er übt selbst in seiner ruhigen Präsenz am Himmel eine fesselnde Wirkung aus, steuert die Gezeiten der Erde und beeinflusst damit auch unser Konzept von Zeit. Seine wiederkehrenden Phasen symbolisieren unaufhörlich den unvermeidlichen Fluss der Zeit und die beständige Veränderung, der wir alle unterliegen.
Die QLOCKTWO MOON 90 präsentiert dem Betrachter den Zeitverlauf eines Mondzyklus in 28 wiederkehrenden Intervallen und ruft ihren Besitzern mit jedem Blick auf sie die Schönheit des Mondes in Erinnerung. Mit ihrer Präsenz verleiht sie jedem Raum eine einzigartige, entspannte Atmosphäre und ist eine Hommage an die Schönheit des Nachthimmels.
Enthüllt wurde dieses einzigartige Objekt aus dem Hause QLOCKTWO nach 5 Jahren Entwicklung am 28. Oktober 2023 im exklusiven Ambiente des, für seine avantgardistische Architektur und sein futuristisches Design bekannte, Concrete in Dubai. In der glitzernden Metropole am Persischen Golf fand die Lancierung zur Zeit eines Vollmondes statt und wurde noch faszinierender durch die Teilmondfinsternis, die den Himmel über der Wüstenstadt erhellte. Nichts wurde von den Machern von QLOCKTWO dem Zufall überlassen und so waren auch, wie es sich heutzutage gehört, Prominente, Uhrenliebhaber, Journalisten und Influencer aus der ganzen Welt anwesend. Dass wir ein Teil davon sein durften, freute uns ganz besonders. Ebenso besonders freuen wir uns dann darauf, dieses exklusive Kunstwerk bei uns in Empfang zu nehmen. Wann wir dieses bei uns in Bern erhalten werden, wissen wir noch nicht, aber auf die nächste Mondfinsternis müssen wir bestimmt nicht warten.
Die Moon wir übrigens ausschliesslich auf Kundenwunsch in Handarbeit gefertigt und ist in neun verschiedenen Farbvarianten sowie als MOON 180 ebenfalls in den Massen 180 x 180 erhältlich. Die Namen der einzelnen Ausführungen sind dabei so wohlklingend wie Dawn, Midnight oder Nightfall und die Legierungen der ca. 100 Blätter sind Platin, Gold und das romantische Moon Gold, welches zu 23,8 Karat aus Feingold und 0,2 Karat Platin besteht.
Sollten Sie Fragen zu diesem einzigartigen Objekt haben, sprechen Sie uns an.

ZRC
11.10.2023DAS LEBEN IST EIN ABENTEUER
Ab dem Jahre 1964 rüstete die Uhrenmarke ZRC die französische Marine mit ihren Uhren aus.
Zwischenzeitlich waren nicht nur die Uhren, sondern auch ZRC abgetaucht. Doch heute ist die Marke unter der Leitung von Georges Brunet, dem Ur-Enkel des Firmengründers, vitaler den je. Ebenso bestechend wie die Verbindung zur französischen Marine, sind auch die Uhren selbst. Sie haben Charakter und sie sind funktional. Das sieht man auf den ersten Blick. Die Krone ist auf 6 Uhr positioniert und wird durch das patentierte «Crown Protection System» geschützt. Und das Armband lässt sich nur schliessen, wenn diese auch fest verschraubt wurde.
ZRC ist die Nischen-Indie-Taucheruhr, welche es mühelos mit den ganz Grossen aus diesem Segment aufnehmen kann.

Entwicklung der Freak in den letzten 12 Jahren
11.09.2023Bereits 2001 brachte Prof. Dr. Ludwig Oechslin die erste Freak zum Laufen. Seither wurde sie stetig weiterentwickelt, war eine der allerersten Uhren mit Hemmungsteilen aus Silizium und ist zu einer Art Laboratorium für Ulysse Nardin geworden. Heute wird der Freak gemeinhin attestiert, die Kategorie der sogenannten Concept-Uhren mit alternativen Zeitanzeigen erschaffen zu haben. Die neue Freak ONE zollt dieser legendären Uhr Tribut, erscheint in zeitgemässem Gewand und verliert dabei nichts von ihrer ursprünglichen Faszination.
Keine Krone, keine Zeiger und kein Zifferblatt. Das Uhrwerk ist König, denn es zeigt die Zeit an.
KEIN ZIFFERBLATT
Normalerweise verstecken mechanische Uhren ihren Antrieb unter einem Zifferblatt. Doch die Freak besitzt kein Zifferblatt. Ihr Uhrwerk ist zugleich der Minutenzeiger, während der Stundenzeiger als Platine auf einer rotierenden Scheibe unter dem Werk sitzt.
KEINE ZEIGER
Die unkonventionelle Freak besitzt weder einen langen noch einen kurzen Zeiger. Stattdessen bekommt ihr orbitales Ein-Stunden-Tourbillon die Rolle des Minutenzeigers, während der Stundenzeiger durch eine pfeilförmige Platine auf einer rotierenden Scheibe ersetzt ist. Ein aufregendes Design, das dennoch leicht ablesbar ist.
KEINE KRONE
Aus Erfahrung müsste eine mechanische Uhr zum Aufziehen des Werks und Stellen der Zeiger eine Krone besitzen. Doch die ursprüngliche Freak kam ohne Krone aus und ersetzte sie durch ein System zur Zeiteinstellung in der Lünette und einen Aufzug im Gehäuseboden.
Die abgebildete ULYSSE NARDIN FREAK ONE besitzt ein Manufakturkaliber UN-240 mit Automatikaufzug, ein fliegendes Tourbillon-Werk, eine überdimensionierte Unruh und Spiralfeder, ein schwarz DLC-beschichtetes Titangehäuse mit Satinierung, eine Lünette aus 18 Karat Roségold und hat einen Durchmesser von 44 mm.

SATTLER – Die Kunst der Grossuhrmacherei
20.04.2023ÄSTHETIK PUR
Durchschnittlich zwei Jahre nimmt die Herstellung aller Einzelteile für eine Präzisionspendeluhr in Anspruch. In exklusiven Kleinserien zeigen sich die Traditionsverbundenheit und die Liebe zum Detail, die zur Qualität der handgefertigten Uhren beitragen. Mit der Classica Secunda 1995 M setzt das Haus Erwin Sattler die grosse Tradition der Präzisionspendeluhren auf eindrucksvolle Weise fort. Mit einer Ganggenauigkeit von ca. ein bis zwei Sekunden pro Monat und dem 30-Tage-Uhrwerk bietet die Classica Secunda 1995 M auch technische Höchstleistung. Die Graham-Hemmung mit Steinpaletten bürgt für eine gleichmässige Übertragung der Energie auf das Pendel.
Vergoldete Räder, Wellen aus schwedischem Spezial-Stahl, fünf Kugellager und elf Rubinlochsteine in zwei Werkplatinen aus vier Millimeter starkem Hartmessing erhöhen Wirkungsgrad und Dauerhaftigkeit dieser „Uhr für Generationen“.

Grand Seiko European Exclusive
09.10.2021Zwei Grand Seiko Uhren, inspiriert von den subtilen Zwischentönen von Licht und Schatten in der japanischen Architektur.
Das 1960 in Japan gegründete Unternehmen Grand Seiko ist ein Spezialist für Uhren mit Schlichtheit und Rafinesse, für Uhren erschaffen mit Perfektion in jedem Detail. Ein ausgewähltes Team von Uhrmachermeistern montiert und reguliert jede Grand Seiko Uhr von Hand, während sie in die reiche Natur blicken, die ihre Uhrmacherwerkstätten umgibt.
Alle Grand Seiko Uhren verkörpern die japanische Affinität zur Natur in der Präzision ihrer Uhrwerke und der natürlichen Schönheit ihres Designs und spiegeln Aspekte der Kunst und Kultur die einzigartig für Japan sind.
Diese beiden Neuheiten, die exklusiv auf dem europäischen Markt angeboten werden, sind durch das Wechselspiel von Licht und Schatten inspiriert, das ein wesentliches Merkmal der traditionellen japanischen Architektur ist.
Inspiration aus der japanischen Architektur
Die Verwendung von Schatten spielt in der japanischen Architektur seit langem eine wichtige Rolle, wo die Schönheit des Schattens in ihren Freiräumen und Winkeln gefeiert wird. Dies ist eine direkte Folge des Einflusses des Klimas und der Geographie Japans auf die Konstruktion von Gebäuden.
Da japanische Gebäude oft aus Holz gebaut sind und angesichts der hohen Luftfeuchtigkeit und der häufigen Regenfällen, mit denen das Land gesegnet ist, würden ihre Stützpfeiler nicht lange genug halten, wenn sie direkt den Elementen ausgesetzt wären. Daher wurden die Dächer so gebaut, um sie vollständig zu schützen, mit überhängenden Traufen von bis zu zwei bis drei Metern. Infolgedessen konnte nur das horizontal unter der Traufe einfallende Licht das Innere beleuchten und viele Bereiche in diesen Gebäuden zwangsläufig im Schatten lagen.
Die Kunst der Architekten bestand darin, diese funktionale Anforderung in eine Gelegenheit für künstlerischen Ausdruck zu verwandeln, und im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich ein einzigartiger Baustil, der nur in Japan zu finden ist, in dem das Spiel von Licht und Schatten eine zentrale Rolle spielt.
Der shōji, ein wichtiger Bestandteil der japanischen Architektur, der das natürliche Licht einfängt.
Im Mittelpunkt dieser Ästhetik steht der shōji, ein beweglicher Papierschirm, der so platziert wird, dass er Licht streuen kann, um einen maximalen künstlerischen Effekt zu erzielen. Der shōji wird durch Bespannen eines Holzgitters mit einem traditionellen japanischen Papier namens Washi bespannt und wird für Fenster, Türen und sogar Außenwände verwendet. Das natürliche Licht, das unter dem Dachvorsprung einfällt, wird durch das shōji eingefangen und erzeugt ein stabiles und schönes Oberflächenlicht, das sich sanft und weit in jeden Raum ausbreitet, alles erhellt und dennoch den schattigen Bereichen ein besonderes Geheimnis und einen besonderen Charme zu verleihen.
„Asakage“ und „Yukage“ – Ausdruck von Licht und Schatten
Mit diesen beiden neuen Zeitmessern bietet Grand Seiko seine eigene Sicht auf die Natur der Zeit und die einzigartig japanische Ästhetik, denn beide Versionen dieser Uhr aus der Elegance Kollektion, SBGW267 und SBGW269, lassen sich von diesen Elementen der japanischen
Architektur inspirieren.
SBGW267 erinnert an „Asakage“, dem blendenden Sonnenlicht am Morgen, das vom shōji absorbiert wird und den ganzen Raum sanft beleuchtet, während SBGW269 das Bild von „Yukage“, das schwache orangefarbene Licht der Abenddämmerung, das der shōji einfängt und den Raum mit Wärme erfüllt.
Traditionelle Inspiration und hochmoderne Uhrmacherkunst
Schlichtheit, Eleganz und Funktion treffen in einem Zeitmesser zusammen.
Beide Modelle verfügen über ein gewölbtes Zifferblatt, das mit einem speziellen Washi-Muster mit einer einzigartig anmutigen, faserreichen Textur versehen ist. Durch die Reflexion des Lichts auf dem Zifferblatt entsteht eine zarte Abstufung, die eine sanfte Harmonie mit der klassischen Form des hochglanzpolierten Gehäuses mit dem ebenfalls gewölbten Saphirglas. Die Uhren werden mit fein strukturierten Kalbslederarmbändern präsentiert, deren zarte Nuancen erzielt werden, indem eine zweite Farbschicht auf die erste aufgetragen wird, die dann nach und nach abgewischt wird. So entstehen eine weiche Textur und ein sanfter Farbton, die sich perfekt in das Gesamtdesign einfügen. Die Stunden- und Minutenzeiger sind sanft geschwungen, um den Konturen des Zifferblatts zu folgen und eine gute Ablesbarkeit sicherzustellen.
Beide Versionen werden vom Kaliber 9S64 angetrieben, einem mechanischen Uhrwerk mit Handaufzug, das eine stabile und hohe Präzision und eine Gangreserve von drei Tagen bei vollem Aufzug bietet. Es hat ein wunderschönes Äußeres mit einem Gefühl der Einklang, die für Handaufzugswerke einzigartig ist.

Porsche Design
19.08.2020Die Marke, welche 1972 von Prof. Ferdinand Alexander Porsche (dem Gestalter des legendären 911er) gegründet wurde, gehört mittlerweile vollständig zum Porsche- Imperium. Dies hat den Effekt, dass die Uhren von Porsche Design ein Alleinstellungsmerkmal erster Güte bekommen haben. Sie sind die einzigen, hochwertigen Uhren, welche direkt mit einem Auto-Hersteller verbunden sind. Und diese Synergien werden von Jahr zu Jahr deutlicher. So ging die Lancierung des neuen 911er Timeless Machine, mit jener der gleichnamigen Uhr einher. Es ist nicht nur die wohl legendärste Auto-Silhouette, welche sich auf dem Zifferblatt der neuen Uhr befindet, es ist zum Beispiel auch das Lederarmband, welches aus dem exakt gleichen Leder wie das Interieur des namensgebenden Porsches hergestellt wurde. Der neue 1919 Globetimer greift ebenfalls Materialien, Lifestyle und Technik seines vierrädrigen Kollegen auf. Die Einstellung der zweiten Zeitzone erfolgt absolut unkompliziert über einen separaten Drücker zum Vor- und einen zum Zurückstellen des Stundenzeigers. Form follows function.

Habring2
11.08.2020Bei Habring2, der einzigen Uhrenmanufaktur Österreichs, rüsten Maria und Richard Habring (daher auch der Name Habring2) kontinuierlich alle ihre bestehenden Uhren-Kreationen mit dem hauseigenen Manufakturwerk «Felix» aus. So ist zum einen der Chrono-Felix und der COS-Felix dazugekommen. Beim Ersten handelt es sich um einen Eindrücker-Chronographen mit 30-Minutenzähler bei 3 Uhr. Beim Zweiten bedarf es mehr Erklärung, um zu verstehen, welch listige Funktion sich hinter der extrem zurückhaltenden Uhr verbirgt. Der Name COS bedeutet Crown Operated System und steht seit 2008 für Habring²‘s exklusive und patentierte Weltneuheit: Ein Chronograph der gänzlich ohne Drücker, Tasten oder ähnliche Bedienelemente auskommt. Zum Betätigen der klassischen Additionsstoppfunktion dient dabei die bekannte und altbewährte Aufzugskrone – ein leichtes Drehen gegen gut fühlbare Widerstände reicht völlig aus. Mit dem hauseigenen Kaliber A11 wird der COS nun zu COS-Felix. Bei den Habrings ticken die Uhren eben auch ein Wenig «different». dm

Grönefeld
09.08.2020«Upside down» könnte man die Strategie der «Horological Brothers», wie sich die beiden Brüder Tim und Bart Grönefeld nennen, bezeichnen. Lanciert haben die beiden Holländer ihre eigene Marke mit Tourbillons und anderen grossen Komplikationen. Dafür wurden Sie auch mehrfach mit dem «Grand Prix d’Horlogerie de Genève» ausgezeichnet und haben damit ihre Reputation verankert. Sie hatten der Uhren-Welt bewiesen, dass sie sich zurecht «The Horological Brothers» nennen und hatten mehr als genügend Kredibilität um ihre exquisite Kollektion mit einer schlichten Dreizeiger-Uhr mit automatischem Aufzug zu erweitern. Entstanden ist dabei ein uhrmacherisches Kunstwerk, welches an zeitloser Schönheit, aufwändigster Verarbeitung und exklusivster Herkunft kaum zu überbieten ist. Nenne tun die beiden Brüder ihren neuen Zeitmesser «1914 Principia». Zusammensetzen tut sich dieser Name aus dem Geburtsjahr ihres Vaters und dem Titel des Hauptwerkes von Isaac Newton, welches sich mit den mathematischen Grundlagen befasst. dm

Grand Seiko
02.08.20202020 ist für Grand Seiko ein ganz besonderes Jahr. Die Marke feiert ihren 60igsten Geburtstag. Hinzu kommt, dass in der Asiatischen Kultur die Bedeutung von Zahlen einen ganz wichtigen Stellenwert hat und die Zahl Sechzig im Besonderen für den Neuanfang steht. Mit dem Erreichen des 60igsten Lebensjahr hat man einen vollen Zyklus des traditionellen Sternzeichenkalenders durchlebt und ist wieder am Anfang angekommen. Und dieser Abschluss eines Zyklus sowie der damit verbundene Neuanfang passt hervorragend zu der Situation, in der sich die Marke befindet. Denn erst drei Jahre ist es her, seit Grand Seiko zu einer eigenständigen Marke geworden ist. Bis zu diesem Zeitpunkt war sie im Grunde nichts anderes als eine Modell-Familie von Seiko. In den letzten drei Jahren wurde tüchtig an einer kongruenten Markenstruktur gearbeitet, so dass man bestens gerüstet ist für den «Neuanfang». Und dass dieses Ereignis mit einer Vielzahl von bemerkenswerten Sondereditionen gefeiert wird, versteht sich von selbst. dm

Armin Strom
22.07.2020In Kooperation mit dem Porsche Zentrum in Bern hat Armin Strom zwei Uhren für uns erschaffen, bei denen das Ticken der Hemmung mehr nach dem Röhren eines Boxermotors tönt und deren Erscheinung das Benzin in den Adern eines jeden Motorsportliebhabers einfrieren lässt. Zwei Uhren, die nicht nur optisch die Motorsport- DNA in sich tragen, sondern bei denen auch umgearbeitete Teile aus einem originalen Porsche 911 GT3 Cup Motor verbaut wurden. Zum einen die «Manual», bei der es die vom legendären Porsche 917 Gulf inspirierte und ins Uhrwerk integrierte Plakette ist. Zum anderen die «Edge», die Federhausbrücken besitzt, die bereits auf der Rennstrecke waren. Zudem findet man ästhetische Elemente wie Felgen, Bremsscheiben und den sich langsam drehenden Luftkühler eines Boxermotors. Und dies alles selbstverständlich in der für Armin Strom bekannten Haut-Horlogerie-Qualität. Entstanden sind zwei Zeitmaschinen, die ihresgleichen suchen und die bereits vor dem ersten Tragen zu Legenden geworden sind. Entstanden durch das Teamplay von Armin Strom, dem Porsche Zentrum Bern und Uhrsachen – made in Bern.

Chronoswiss
02.06.2020Der Name «Chronoswiss» kann leicht irreführen. Vorschnell liesse sich glauben, Chronoswiss könnte ein typisch schweizerischer, Chronografen-Hersteller sein. Doch dem ist nicht ganz so. Gerd-Rüdiger Lang, gelernter Uhrmacher aus Deutschland, war Leiter der deutschen Heuer-Niederlassung als diese 1980 infolge der Schweizer Uhrenkrise geschlossen wurde. Darauf machte er sich mit der Herstellung genau dieser Produkte selbstständig, welche allem Anschein nach nicht mehr gefragt waren: mechanische Armbanduhren. Sein Glaube an die mechanische Uhr und die Strahlkraft der Schweiz waren so gross, dass er seine neu gegründete Firma «Chronoswiss» nannte (Chronos kommt aus dem Griechischen und bedeutet Zeit). Als Wiedererkennungsmerkmal wählte Lang die Zeitdarstellung in der Art des Regulators und bestückte das Gehäuse mit einer markanten, zwiebelförmigen Krone. Seit 2012 ist Chronoswiss in den Händen des Schweizer Unternehmerpaares Ebstein und hat den Hauptsitz, dem Namen folgend, in die Schweiz nach Luzern verlegt.

Louis Erard
14.05.2020Für Louis Erard ist ein neues Zeitalter angebrochen. Die Marke, dessen Gründung auf das Jahr 1929 zurückgeht, wurde 2003 durch den gewieften Unternehmer Alain Spinedi zu neuem Leben erweckt. Die Neuartigkeit und der damit verbundene Erfolg beruhte auf der für die damalige Zeit neuen Einstiegspreislage für mechanische Uhren (deutlich unter CHF 1‘000.-). Schon bald folgten auch die Grossen, wie Tissot oder Certina, diesem neuen Trend. Diese konnten dank ihren Volumen noch tiefer kalkulieren. Somit wurde es in den letzten Jahren sehr eng für Louis Erard. Und just zu jenem Zeitpunkt kam die Rettung in der Person von Manuel Emch. Jenem charismatischen Uhrenkenner, der bereits Jaquet Droz sein heutiges Erscheinungsbild gegeben und bei RJ-Romain Jerome den Turnaround geschafft hatte. Und nun ist Louis Erard an der Reihe. Geblieben ist die Positionierung in der Einstiegspreislage, jedoch neu in jener der «collectable Haute-Horlogerie». So sind zum Beispiel zwei limitierte Regulatoren entstanden, für deren Design niemand geringerer als Eric Giroud (MB&F, Vacheron Constantin, etc.) und Alain Silberstein verantwortlich zeichneten.

Habring2
25.07.2018Felix ist gross geworden. Zurecht ist er der Stolz im Hause Habring. Sein Name kommt von «Tu Felix Austria», einer Redewendung aus den Zeiten der Habsburger, die so viel heissen soll wie: «Kriege führen sollen andere, du, glückliches Österreich heirate und vermehre so deinen Besitz.» Für Maria und Richard Habring ist klar, dass ihr Felix mit seinem selbst entwickelt und gebauten Uhrwerk den Fortbestand der einzigen Uhrenmanufaktur in Österreich sichern wird. Dies hat er bewiesen in dem sein Uhrwerk, das A11 (A für Austria und 11 für den Beginn der Entwicklung 2011), als Basis für weitere Habring-Spezialitäten dient. So ist der «Doppel Felix» entstanden. Der Doppelchronograf, auch Rattrapante genannt, ist die wohl bekannteste Uhr von Habring2. Ebenfalls eine typische Habringsche Spezialität ist der Foudroyante oder die blitzende Sekunde zu deutsch. Auch für deren Antrieb sorgt nun das komplett in Eigenregie gefertigte Kaliber A11. Entstanden ist dabei der «Foudroyante Felix». Mit Freuden heissen wir diese beiden Österreicher in der Schweiz willkommen und glauben, dass sie bei Uhrsachen das richtige Zuhause gefunden haben.

Armin Strom Neuheiten 2018
03.07.2018Bei seiner neusten technischen Errungenschaft ist Claude Greisler, Chefentwickler von Armin Strom, weit in die Tiefen der Physik vorgedrungen. Er ist dabei auf ein Phänomen gestossen, welches sich bis heute nicht eindeutig erklären lässt. Dabei wird ein Körper ohne direkte Berührung durch einen anderen in Schwingung versetzt. So können beispielsweise die akustischen Töne einer Gitarre, die sich in der Nähe befindenden Seiten eines Flügels zum Schwingen und somit Tönen bringen. Wer jetzt zu denken glaubt, Armin Strom habe seinen Uhren einen Klang verliehen, hat weit gefehlt. Claude Greisler ist der Techniker. Ihm geht es um die Präzision seiner Zeitmesser. Und genau dazu nutzt er die Resonanz. Dass dabei eine höchst ästhetische und geradezu mystisch zu betrachtende Komplikation entstanden ist, macht die Uhr umso attraktiver. Wie für Armin Strom typisch, sind die beiden in Resonanz schwingenden Unruhen bereits von der Zifferblattseite her ersichtlich. Dabei synchronisieren sich diese gegenseitig und der Gang der beiden Hemmungen wird durch ein Differenzialgetriebe zusammengeführt und gemittelt. Schlicht genial.

Neuheiten 2017 – Ressence
13.12.2017Ressence
Nach dem Typ 1, Typ 3 und letztes Jahr dem Typ 5, hätte man dieses Jahr den Typ 7 oder zumindest etwas zwischendrin erwarten können. Doch selbst bei der Namensgebung seiner Modelle und der Abfolge derer Lancierungen, lässt sich Benoît Mintiens nicht von gängigen Konventionen und Erwartungen lenken. Er macht einen Schritt zurück, wenn auch nur bei der Namensgebung, und kreiert ein komplett neues Gehäuse für den Typ 1 und nennt ihn sinnigerweise Typ 12. Dieses neue Gehäuse ist weniger dematerialisiert als seine Vorgänger. Es ist zum ersten Mal aus Edelstahl, hat eine Kissen-Form und nimmt einige Codes klassischer «Dress Watches» auf. Wie alle anderen Uhren von Ressence, hat auch diese keine Krone. Erleichtert wird das Aufziehen und Richten der Uhr aber durch das Ausklappen eines praktischen Hebels auf der Rückseite der Uhr. Dieser erinnert an das Aufziehen alter Wanduhren. Dabei lässt der Industriedesigner Mintiens sein zur Marke gewordenes Mantra «renaissance de l’essentiel – Ressence» nicht aus den Augen und erschafft erneut einen höchst aufwendigen Zeitmesser der die «Wiedergeburt des Wesentlichen» perfekt verkörpert.

Neuheiten 2017 – Meistersinger
07.12.2017Meistersinger
Zum ersten Mal wird es dieses Jahr bei Meistersinger richtig sportlich. Zwar gibt es bereits Chronographen mit dem für Meistersinger so typischen Einzeiger-Prinzip, doch werden diese stets in einem klassischen, eleganten Gehäuse angeboten. Das Gehäuse der neuen Salthora Meta X hingegen, wirkt mit dem markanten Kronenschutz kräftig und die sportliche Dreh-Lunette verleiht der Uhr einen geradezu energischen Charakter. Geblieben ist selbstverständlich der «Solo-Zeiger», welcher auch diese neue Uhr zu einer richtigen Meistersinger macht. Ausnahmsweise zeigt dieser eine Zeiger für einmal ganz gewöhnlich die Minuten an, denn die Stunden werden, von einem speziell entwickelten Mechanismus, in einem Fenster bei 12 Uhr angezeigt. Somit spricht Meistersinger mit der Salthora Meta X gleich zwei neue Kundensegmente an: Diejenigen, die es etwas robuster brauchen oder mögen und gleichzeitig auch diejenigen, welche die Pure Ästhetik des Einzeiger-Prinzips schätzen, trotzdem jedoch einen konventionellen Minutenzeiger bevorzugen. Aber auch dieser Zeitmesser ist eine richtige Meistersinger und wird seinen Besitzer keinesfalls mit Sekunden hetzen.

Neuheiten 2017 – Armin Strom
01.12.2017Armin Strom
Vermochten die kreativen Macher von Armin Strom in der Vergangenheit mit konstanter Regelmässigkeit mit einem neuen Uhrwerk zu überraschen, so wurde dieses Jahr gleich ein komplett neues Konzept vorgestellt. Dieses neue Konzept heisst: Watch Configurator. Es verbindet die ungewohnt grosse Fertigungstiefe im eigenen Haus mit dem immer grösser werdenden Wunsch der Uhrenliebhaber nach Individualität und nutzt die neusten technologischen Möglichkeiten gekonnt. Dabei sucht sich der Kunde zunächst das gewünschte Uhrwerk aus. Anschliessend kann er Farben, Gravuren und wenn gewünscht sogar eine Skelettierung wählen. Das eigens entwickelte Online-System bietet dem Nutzer darüber hinaus die Möglichkeit, Gehäusematerial, Art und Farbe von Zifferblatt und Zeigern, die Schliesse sowie kleinste Details, wie etwa die Farbe der Naht am gewünschten Armband, selbst zu bestimmen. Damit man bei all diesen Möglichkeiten nicht den Überblick verliert, die Dimensionen der Uhr auf seinem Handgelenk betrachten, die Materialien erfühlen und die Faszination erleben kann; dafür aber sind und bleiben wir bei Uhrsachen zuständig.

RJ-Romain Jerome DNA of famous legends
11.12.2013Die Firma ist jung, lag schon einmal am Boden und erlebt, seit Manuel Emch am Ruder steht, einen famosen Aufschwung. Der Grundstein des Erfolgs dieser Nischenprodukte liegt im ebenso augenzwinkernden wie innovativen Umgang mit Legenden. Und in schier unerschöpflicher Kreativität, gepaart mit Fleiss und akribischer Umsetzung.
Er war keine 30, als er CEO der Firma Jaquet Droz wurde, und damit einer der Jüngsten, die jemals an der Spitze einer Uhrenmarke standen. Und nicht mancher hat die kreative Qualität des vielseitig begabten Tausendsassas Manuel Emch.
Nach mehreren erfolgreichen Jahren in dieser Funktion, mit einiger Freiheit, aber eben doch eingebunden in die Strukturen der grossen Swatchgroup, zog es Emch zu neuen Abenteuern. Die 2004 gestartete Firma «RJ – Romain Jerome» aus Genf sollte sich als ideale Spielwiese entpuppen. Bei seinem Antritt 2009 verliefen die Anfänge allerdings alles andere als geordnet und gesittet. Der vorherige CEO hatte zwar viele Ideen gehabt, doch bei der seriösen Umsetzung haperte es gewaltig. Ein weiteres grosses Manko war das Fehlen einer eigentlichen Produktion, es wurde alles ausgelagert. Kurz nach seinem Arbeitsantritt in Genf wollte Emch die Produktion bei seinem Hauptzulieferer besuchen. Man beschied ihm am Telefon, dass es gut sei, dass er sich gerade melde – die Firma sei nämlich in Liquidation. Emch, Mann der Tat mit Talent zur Improvisation, mietete kurzum einen Lieferwagen, fuhr beim besagten Zulieferer vor und packte eigenhändig sämtliche Romain Jerome-Uhren und die vorhandenen Bestandteile ein. Kartons, von denen zum Teil nicht einmal klar war, was sie überhaupt enthalten. «Ziemlich herausfordernd» nennt Emch rückblickend diesen schwierigen Moment, mit einem Schmunzeln im Gesicht.
Das wirklich Gute war aber die bereits aufgegleiste Idee der «DNA», die in die Uhrengehäuse oder Zifferblätter integriert wird. 2007 hatten die Vorgänger die Modelle der «Titanic»-Serie lanciert, die Spurenelemente aus dem Wrack des legendären Ozeanliners enthielt. Auch die «Moon-DNA»-Serie war schon angedacht.
Visionär und Realist
Emch hakte hier ein und entwickelte die Grundidee mit der ihm eigenen Gründlichkeit weiter. Er ist nicht nur Visionär, sondern auch Realist. Die Kollektionen wurden mit grosser Präzision und Konsequenz ausgebaut. Wenig Schlaf, ein gutes Netzwerk und das Vertrauen der Aktionäre sorgten dafür, dass die Firma innert zwei Jahren Fuss fassen konnte. Professionelle Strukturen für Produktion, Design, Marketing und Vertrieb wurden aufgebaut. Emch scharte eine verschworene Crew um sich, teils aus früheren Weggefährten, auf die er zählen, und die er zu Höchstleistungen motivieren konnte. Seit er am Ruder ist, sorgt «RJ – Romain Jerome» regelmässig für viel Aufsehen. Dies in erster Linie mit den unverkennbar und eigenwillig gestylten Uhren. Aber auch mit extrem pfiffigen, grafisch und illustrativ hervorragenden Werbemotiven.
Herzstück bildet das «DNA of famous legends»-Prinzip: Elemente aus der Titanic, aus Mondgestein oder – in einer Blitzumsetzung kurz nach dessen Ausbruch – Lava des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull. RJ Capsules heisst die andere Kollektion mit Umsetzungen wilder Ideen, die teils Bezug auf die Jugendheldenlegenden Emchs nehmen. So wird ein DeLorean-Auto, bekannt aus den kultigen «Back to the Future»-Filmen, verewigt, aber auch die Freiheitsstatue in New York. Homöopathische DNA-Spuren sozusagen, aber in ihrer Echtheit garantiert. Einen weiteren Coup landete Emch mit den «Space Invaders»- und «Pac-Man»-Modellen, einer Art Liebeserklärung des bekennenden Spielers dieser Mütter aller Computerspiele. Seine Affinität zu Moderner Kunst kam zum Zug beim Projekt einer Uhr mit dem Künstler John Armleder. Und den inneren Rocker lebte er mit dem neuesten Streich aus, der «Tatoo-DNA»-Uhr, die mit dem legendären Londoner Tätowierkünstler Mo Coppoletta entstand.
Aber auch uhrentechnisch höchst interessante Leckerbissen führt RJ-Romain Rerome unterdessen in der Auswahl. Das in Zusammenarbeit mit dem kongenialen Genfer Konstrukteur Jean-Marc Wiederrecht entwickelte Modell «Spacecraft» erinnert im Aussehen an eine Mischung aus Darth Vader-Helm und Siebziger-Jahr-Science-Fiction-Raumschifftacho. Unter der kantigen Titanhaube steckt dann feinste, subtile Mechanik.

Sonderedition «Uhrsachen»
11.12.2013Die Bezeichnung «Grand Cru» bezieht sich in der Regel auf Wein und gilt als Synonym für besondere Qualität. Für Uhren ist diese Bezeichnung eher ungebräuchlich. Würde es sie aber geben, so würden die Sondereditionen von Uhrsachen bestimmt auch dazugehören.
Es ist für Uhrsachen zur Tradition geworden, in regelmässigen Abständen limitierte Sondereditionen mit Partner-Marken zu lancieren. Für Uhrsachen’s neusten Coup fiel die Wahl auf Vogard. Vogard ist der Spezialist für Weltzeituhren und die einzige Marke überhaupt, die sich ausschliesslich mit den Zeitzonen beschäftigt. Diese werden mit dem von Vogard patentierten Einstellmechanismus direkt über die Lunette eingestellt. Es liegt nahe, dass bei dieser neusten Sonderedition für die Kennzeichnung des «Längengrades +1» nicht etwa Paris oder Berlin steht, sondern Uhrsachen und Bern. Doch damit hört die Individualisierung nicht auf. Das Zifferblatt und der 24-Stunden Zeiger wurden in den Hausfarben Schwarz und Orange gestaltet. Auch die Komposition der weiteren Komponenten ist ausschliesslich in dieser Sonderedition erhältlich. Es gibt zwei unterschiedliche Versionen, welche auf je 10 Stück limitiert sind. Die eine mit einem matten Stahlgehäuse und einem schlichten schwarzen Zifferblatt, die andere mit einem PVD beschichteten schwarzen Gehäuse und einem Zifferblatt aus massivem Karbon. Beide Varianten werden von einem mechanischen Uhrwerk mit automatischem Aufzug angetrieben, welches in den Ateliers von Vogard zur perfekten Weltzeituhr getrimmt worden ist.
Vogard: Zeitzonen einfach gemacht
Für Dominik Maegli stand fest, dass auch nach der Übernahme von Uhrsachen durch die Familie Maegli diese aussergewöhnlichen Kooperationen, stets dem Kredo «tick different» folgend, weitergeführt werden sollen. Und er ist sich sicher, dass er auch für dieses neuste Projekt mit Mike Vogt den richtigen Partner gefunden hat. Dieser gründete 2002 die Marke Vogard (zusammengesetzt aus Vogt und Avantgarde). Da Vogt keine halben Sachen mag, verpflichtete er einen renommierten Uhrmacher für die Entwicklung seiner Zeitzonenkomplikation. Entstanden ist eine Uhr mit einem verblüffend cleveren Mechanismus. Wird der unterhalb der Krone angebrachte Hebel gelöst, kann man die Drehlunette bewegen, und dies in beide Richtungen. Dieser Drehring ist mit dem normalen Stundenzeiger und einem 24-Stundenzeiger gekoppelt. Auf diese Weise kann jederzeit abgelesen werden, welche Zeit an einem bestimmten Ort auf der Welt ist. Der 24-Stundenzeiger hilft dabei herauszufinden, ob an der Zieldestination Tag oder Nacht ist. Dieses Feature ist äusserst praktisch, nicht nur für den Reisenden. Auch wenn Sie Ihren Freund in Kalifornien oder den Produktionschef in China anrufen möchten, hilft der «Timezoner». Einfach schnell die Lunette auf «Los Angeles» oder «Hong Kong» drehen und schon sieht man, ob die Zeit dafür opportun ist.
Eine patentierte Weltneuheit schuf Mike Vogt schliesslich mit der Indikation der Sommerzeit. Auch in diesem Fall gilt: Die besten Lösungen sind oft die einfachen. Mit einem «S», verbunden mit einem Strich zu den entsprechenden Destinationen, stellt man die Lunette ganz einfach auf die Sommerzeit ein. Die Erfindung ist so gut, dass sie sogar von anderen kopiert wurde. Der Schutz des geistigen Eigentums konnte aber erfolgreich durchgesetzt und dessen Missachtung mit einer Schadenersatzzahlung bestraft werden.
Die Uhren von Vogard sind solide und robust gebaut. Die wichtigsten Werkskomponenten wie Platine und Räderwerk entwickelt Vogard in Eigenregie. Als Basisantrieb dient ein Valjoux 7750 Werk, das reichlich modifiziert wird, bevor es mit der Vogard-Platine und der Komplikation verbunden wird. Grosser Knackpunkt war die Übertragung der Lunettendrehung auf die Achse, auf der die Zeiger sitzen. Die Komponenten für dieses Modul werden von hochqualifizierten Zulieferbetrieben in der Region Biel exklusiv für Vogard gefertigt. Die gesamte Endmontage wird in den Ateliers von Vogard, in dem an die Uhrenmetropole Biel angrenzenden Städtchen Nidau, vorgenommen.
Auch die Konstruktion und Fertigung des Gehäuses sind sehr komplex. Es misst 43 mm Durchmesser und ist 10 bar wasserdicht. Der Hebel für die Aktivierung der Drehlunettenfunktion sowie die spezielle Öffnung für das Kronenrad stellen hohe Anforderungen an den Gehäusebauer. Das gewölbte Saphirglas und die massiven Anstösse geben der Uhr einen Look, der Stärke und Vertrauen ausstrahlt.
Starke Partnerschaften
Somit ist klar, dass Vogard definitiv der passende Partner für die vierte «Uhrsachen-Edition» ist. Die Marke widerspiegelt auf das Vortrefflichste die von Uhrsachen geschätzten Werte.
Den Startschuss dieser mittlerweile legendären Kooperationen machte Uhrsachen mit dem Uhrenhersteller Meistersinger mit der «Uhrsachen-Einzeigeruhr». Deren Erfolg war überwältigend: Alle 75 Uhren waren innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Das machte Mut für weitere Projekte. In Zusammenarbeit mit der Bieler Uhrenfirma Glycine folgte die «Coral Diver». Auch diese robuste Taucheruhr wurde natürlich in den Uhrsachen-Hausfarben Schwarz und Orange gestaltet. Von der limitierten Serie wurden 50 Uhren mit orangem Superluminova-Zifferblatt und 50 Uhren mit schwarzem Zifferblatt hergestellt. Von beiden Varianten sind noch wenige Stücke erhältlich. Der dritte Streich gelang mit der «Uhrsachen-Turbine» von Perrelet. Abraham-Louis Perrelet erfand 1778 den automatischen Aufzug und revolutionierte damit die Uhrmacherei. An diese wegweisende Erfindung erinnert der frei drehende Turbinenflügel auf der Zifferblattseite. Dabei kontrastieren die orangen Zeiger wunderschön auf dem schwarzen Hintergrund. Sämtliche Zeitmesser, aus dieser auf lediglich 10 Exemplare limitierten Serie, fanden schnell einen neuen Besitzer und sind somit bereits vergriffen.
Der erneute Erfolg dieser «Uhrsachen-Editionen» festigt die kühnen Pläne für weitere Kooperationen, die immer ein wenig anders ticken werden.

Uhrsachen geht auf eine mystische Reise mit RJ-Romain Jerome
23.01.2013Uhrsachen tickt auch im neuen Jahr, und unter neuer Führung immer noch anders. Dies beweist die neue Partnerschaft mit der Genfer Uhrenmarke RJ-Romain Jerome. Auch bei RJ tickt man ein wenig anders. Wer sonst käme auf die Idee, Uhren aus original Stahl-Teilen der Titanic zu bauen und eine Silberlegierung mit Mondstaub-Partikeln zu kreieren? Die noch junge Uhrenmarke (2004 gegründet) prosperiert unter der Leitung von Manuel Emch. Aufmerksamen «Tick different»-Lesern ist dieser junge Non-Konformist natürlich keine unbekannte Person. War er doch für die Wiedergeburt und den Aufbau von Jaquet Droz, so wie wir diese wundervolle Marke heute schätzen und lieben, verantwortlich.
RJ-Romain Jerome’s einzigartiges Konzept heisst «DNA of famous legends». RJ ermöglicht es dem Träger dieser höchst emotionalen Zeitmessern ein Stück Geschichte am Handgelenk zu tragen. Denn diese Uhren sehen nicht nur aussergewöhnlich aus, sie sind es auch. Jeder Zeitmesser enthält DNA einer zeitgenössischen Legende. Dies reicht von der legendären Titanic, über die Mondlandung bis hin zu dem Computer-Spiel «Space Invader», welches eine ganze Generation Jugendlicher in seinen Bann zu ziehen vermochte. Es scheint als seien dem kreativen Team um Manuel Emch keine Grenzen gesetzt. Obwohl sich diese Zeitmaschinen in einem für die Uhrmacherei sehr ungewöhnlichen Universum bewegt, sind sie nach höchstem Qualitätsstandart gefertigt. Gerade auch den Zifferblättern wird besonders grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Entweder sind dies überaus komplizierte technische Konstruktionen oder sie werden, wie zum Beispiel das Zifferblatt der EYJAFJALLAJÖKULL-DNA (aus Lavagestein des Isländischen Vulkans), im Atelier von Daniel Haas hergestellt. Auch der Name Daniel Haas sollte dem regelmässigen «Tick different»-Leser bekannt sein. So wurde in der Ausgabe N° 4 seine höchst seltene Arbeit, das Herstellen von Mineralien-Zifferblättern, ausführlich beschrieben.
Konnte sich RJ-Romain Jerome in der Bijouterie Maegli in Solothurn bereits äusserst erfolgreich etablieren, so geht die Invasion dieser fantastischen Marke mit einer geballten Ladung an Kreativität weiter nach Bern. Hier bei Uhrsachen ist RJ gut gelandet und bereit die Handgelenke von denen zu schmücken, welche sich auf das Einzigartige, das Mystische und das Aussergewöhnliche dieser emotionalitätsgeladenen Zeitmesser einlassen wollen.
RJ-Romain Jerome bei Uhrsachen
Gerne tauchen wir mit Ihnen ein in die Welt von RJ, erzählen Ihnen die faszinierenden Geschichten, welche die Marke umgeben und beraten Sie bei der Wahl ihres persönlichen RJ-Zeitmessers. Doch auch wenn unsere Dienstleistungen noch so umfangreich sind, in einem Punkt sind Sie auf sich alleine gestellt. Sie selbst müssen Ihrer Partnerin erklären, weshalb ein erwachsener Mann sich einen, einem Raumschiff ähnelnden Gegenstand ums Handgelenk bindet.

Ulysse Nardin Classico Luna: Mondphasen einmal anders
04.10.2012Uhren mit Mondphasenanzeige sind nicht sehr verbreitet. Meist sind sie dann sehr ähnlich, und in der Sache relativ banal. Doch es gibt pfiffige Ausnahmen
Die Classico-Serie von Ulysse Nardin bestand bis anhin aus schön flachen Uhren mit der klasssischen Dreizeiger-Datums-Konfiguration. Die Linie erhält jetzt eine Erweiterung mit den neuen Modellen Classico Luna, in Damen- und Herrenausführung, mit einer aussergewöhnlichen Mondphasenanzeige.
Das Prinzip dieser Anzeige ist indes bei Ulysse Nardin nicht gänzlich neu, es basiert, einmal mehr, auf den Arbeiten von Ludwig Oechslin im Zusammenhang mit dem limitierten Uhrmacher-Meisterwerk «Moonstruck». Sie gibt den Umlauf des Monds in einer sehr präzisen und realistischen Darstellung wieder. Der Mond reflektiert das Licht der Sonne, während er sich im Uhrzeigersinn um die Erde dreht. Bei der Classico Luna zeigt sich der Lichteinfall am eigenen Mond, der sich innerhalb von 12 Stunden einmal um das Zentrum des Zeitmessers – ein Abbild der Erde – dreht. Bis zur Vollendung des 29,5 Tage dauernden Mondzyklus wechselt die Farbe der Mondphasenscheibe mit dem ab- beziehungsweise zunehmenden Mond. Das Ablesen der Mondphase ist damit sehr einfach. Etwas komplexer ist die Einstellung, die mit einem Drücker im Gehäuse vorgenommen wird.
Die Classico Luna hat ein Automatikwerk, und es gibt sie als Herrenuhr mit 40 und als Damenuhr mit 35 mm Gehäusedurchmesser, jeweils in Stahl oder 18 Karat Roségold. Die Herrenausführung ist elegant und schlicht, bei den Damenmodellen gibt es die beliebten Details wie ein Zifferblatt aus Perlmutt, mit Diamantindexen sowie, je nach gewünschtem Glamourfaktor und Budget, reichlich Diamantenbesatz auf Lunetten und Bandanstössen.

Neuheiten 2012 von Glycine: Kontinuität statt Revolution
10.04.2012Nach der Übernahme durch Stephan Lack im Jahr 2011 war man gespannt, was Glycine 2012 an Neuheiten präsentieren würde. Glycine-Fans können beruhigt sein: Der neue Eigentümer setzt auf Kontinuität.
Die legendärste Uhrenfamilie von Glycine heisst Airman. Als 1953 der erste Airman erschien, war er revolutionär, denn Uhren mit verschiedenen Zeitzonen gabe es so gut wie keine. Seither hat Glycine das Thema immer wieder neu interpretiert. 2011 wurde der Airman SST Chronograph vorgestellt, in einem kissenförmigen Gehäuse mit 43 mm Durchmesser, das so typisch ist für die späten 60er Jahre. SST steht für Super Sonic Transport, dem Projekt des ersten Überschall-Passagierflugzeugs von Boeing in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als der Glaube an die Technik durch nichts zu bremsen war. Als Hommage ist auf dem Boden eine Reliefgravur dieses Flugzeugs zu sehen, das nie über das Stadium eines Projekts hinausgekommen ist.
Nun folgt mit dem Airman SST12 bereits die 25. Generation des Airman. Mit dieser Uhr kann man drei Zeiten ablesen: Ein Zeiger zeigt die Ortszeit im 12-Stunden-Format an, ein zweiter (der rote) kann individuelle auf eine zweite Zeitone eingestellt werden. Die unter dem Glas angebrachte zusätzliche Drehlunette schliesslich ermöglicht die Anzeige einer dritten Zeit. Gedreht wird sie über eine originalgetreue Schlitzkrone auf der 2-Uhr-Position, die man ganz einfach mit einer Münze bedient.
Wie fast immer bei den Airman-Modelen ist auch die SST12 in einer „Puristen-Version“ lieferbar, als 24-Stunden-Uhr, die dann allerdings nur noch zwei Zeitzonen anzeigt. Das Zifferblatt gibt es in schwarz oder mit einem schwarzblauen Farbverlauf.
Sehr „Seventies-like“ ist die Version mit schwarzem Zifferblatt und oranger Drehlunette. Bei der Technik setzte man auf Bewährtes: Das ETA 2893-2 versieht seit vielen Jahren in manchen Airman-Modellen seinen Dienst, so auch im SST12. Den Airman SST gibt es ab CHF 1750.-
Neue Varianten des Combat Sub
Auch der robuste Taucher Combat Sub ist schon einige Jahre ein sicherer Wert in der Glycine-Kollektion. Er besticht durch sein solides 42 mm-Gehäuse mit Saphirglas, seine gute Ergonomie und durch sein exzellentes Verhältnis von Preis und Leistung. Hier bekommt man wirklich viel Qualität für sein Geld – eine ideale Uhr für viele Lebenslagen. Unter der neuen Führung bringe Glycine ein wenig mehr „Lifestyle“ in ihr Sortiment. Neu sind zwei Modelle in schwarz PVD-beschichtetem Gehäuse: der edle „Golden Eye“ mit braun-/goldener Lunette und nobler vergoldeter Krone und Zeigern sowie der mystische, ganz in schwarz gehaltene, gut getarnte Combat „Stealth“.
Neu im Angebot sind schicke Stoffbänder, die gut mit den neuen Farbvarianten der Combat Sub harmonieren. Aber auch das bewährte, massive, matt gebürstete Stahlband ist noch erhältlich.
Airman 17 und 18 in einer königlichen Ausführung
Einen leichten Facelift gab es auch noch für die Modelle Airman 17 und Airman 18. In der Version „Royal“ erhalten sie eine Lunette mit einem Inlay aus 18 Kt. Rotgold, was der Uhr zu viel Schick verhilft.

Mit Jaermann & Stübi beim Golfen zählen und umrechnen
03.04.2012Die raffinierten Golfuhren von Jaermann & Stübi sind bei Uhrsachen seit ihrer Lancierung im Sortiment – ja, wir waren sogar der allererste Kunde des innovativen jungen Unternehmens, das sich unterdessen auf dem Markt etablieren konnte. Mit der Trans Atlantic wird die Kollektion nun um ein neues Modell ergänzt.
Golf wurde in England erfunden. Unmögliche Masseinheiten auch. Beides hat man in viele Länder exportiert. An vielen englisch beeinflussten Orten rechnet man nach wie vor in Yards (und noch in einigen anderen kuriosen Einheiten). Ein Yard entspricht ca. 3 Fuss oder 0.91 Metern. Gemäss Wikipedia wurde das Yard schon im Jahr 1011 von König Heinrich I. als „Abstand von seiner Nasenspitze bis zur Daumenspitze seines ausgestreckten Armes“ festgelegt. Erst seit Ende des 19. Jahrhunderts wird das Yard vom Meter abgeleitet. Und um es ja nicht allzu einfach zu machen, gilt ein amerikanisches Yard 914,4019 mm, ein englisches hingegen 914,3993 mm. Immerhin konnte man sich 1956 darauf einigen, dass ein Yard international als 0,9144 Meter definiert wird. Die Briten verpflichteten sich 1973, sich der europäischen metrischen Systematik anzupassen, mit einer Übergangsfrist, die ursprünglich bis 2010 hätte gelten sollen, jetzt aber auf unbestimmte Zeit verlängert wurde. Item.
Urs Jaermann spielt auf beiden Seiten des Atlantiks Golf. Er mochte nicht warten, bis endlich ein einheitliches, vernünftiges Messwesen eingeführt wird und konzipierte darum flugs einen in die Golfuhr integrierten Yard-Meter-Umrechner. Das tönt komplizierter, als es ist: Auf einer Tabelle auf der drehbaren Lunette sind bei den Yards die entsprechenden Meterzahlen aufgedruckt. Einfache Lösungen waren schon meistens die besten.
Jaermann & Stübi Trans Atlantic Chronometer
Der neue Trans Atlantic Chronometer kommt in einem sehr noblen grünen Farbkonzept ans Golfer-Handgelenk und hinterlässt auf oder auch neben dem Green einen exzellenten Eindruck.
Sonst bleibt bei der bewährten Golfuhr vieles beim Alten: Der geniale mechanische Golfzähler zeigt weiterhin die Anzahl Schläge pro Loch, die gespielten Löcher, die Gesamtzahl Schläge sowie einen Handicap-Vergleich an. Neu ist das automatische Uhrwerk A10 auch chronometerzertifiziert und hat somit die strengen Tests der C.O.S.C. bestanden. Verbessert wurde auch der Rückstellmechanismus, mit dem man am Ende der Partie alle Zähler wieder in die Ausgangsstellung bringt. Und auch die Zeiger wurden überarbeitet, sie sorgen jetzt für eine verbesserte Ablesbarkeit.
Und neu ist auch der Preis: Jaermann & Stübi konnte die Preise generell um einige Prozente senken – der neue Chronometer ist mit Kautschukband für CHF 8000.- erhältlich.

Die Turbine taucht ab
31.03.2012Mit dem Modell Turbine, 2009 vorgestellt und seither in verschiedensten Varianten aufgelegt, gelang Perrelet auf Anhieb ein Achtungserfolg. Jetzt folgt das Tauchermodell. Völlig neu war die Idee mit einem auf dem Zifferblatt drehenden Turbinenflügel. Uhrsachen brachte von dem Modell gar eine limitierte Serie in den Hausfarben schwarz/orange auf den Markt, die im Nu ausverkauft war. An der Baselworld 2012 erhielt die Turbinen-Familie nun Zuwachs. Zum Thema Fliegerei gesellt sich nun das Thema Wasser. Turbine Diver heisst die Neuvorstellung, bei der der Rotor mit seinen 11 elegant geschwungenen Schaufeln an eine U-Boot-Schraube erinnert. Raffiniert ist das mit der Leuchtmasse Superluminova bedeckte eigentliche Zifferblatt im Hintergrund. Wenn sich die „Schraube“ dreht, scheint es leuchtend hindurch. Das Gehäuse aus Stahl (als Variante auch mit einer schwarzen DLC-Beschichtung) mit Saphirglas auf Vorderseite und im Gehäuseboden passt mit seiner aufwendigen Konstruktion bestens in die Perrelet-Familie. Es ist mit 47,5 mm Durchmesser gross, aber ergonomisch schlau geformt, was sich positiv auf die Tragbarkeit auswirkt. Natürlich hat sie Alles, was zu einer richtigen Taucheruhr gehört: Eine innenliegende Drehlunette fürs Einstellen der Abtauchzeit, in verschiedenen Farbkombinationen markant und für gute Ablesbarkeit gestaltet. Und eine Wasserdichtigkeit von 30 atm, was in der Theorie für eine Tauchtiefe von 300 Metern ausreichend wäre. Im Innern tickt das mechanische Werk P-331 mit automatischem Aufzug. Es wird von Soprod produziert, der Werkproduzentin, die in Händen des selben Besitzers ist wie die Firma Perrelet – wodurch es sich sogar Manufakturwerk nennen lassen darf.

Nomos Zürich – definitiv ein zukünftiger Klassiker
31.03.2012An Humor fehlte es den Nomos-Macherinnen und -Machern noch nie. Und auch nicht an einer Prise Augenzwinkern. So muss man sich als Uhrenfirma aus Glashütte im Osten Deutschlands erst mal trauen, eine Uhr „Zürich“ zu nennen. Doch dafür gibt es gute Gründe.
Als leichte Verneigung in Richtung Zürich wollen die Glashütter die Namensgebung der Uhr verstanden wissen. Sicher ist es aber eine Verneigung vor Hannes Wettstein, dem leider zu früh verstorbenen Zürcher Gestalter und Designer. Er konnte seinen letzten Uhrenwurf nicht mehr vollendet in den Händen halten.
„Zürich“ heisst die Uhr von Nomos, die seit Ende 2009 erhältlich ist, anfangs nur in homöopathisch kleinen Stückzahlen. Viel Gutes aus zwei Welten trifft bei der „Zürich“ zusammen. Wettsteins Handschrift ist unverkennbar, gerade die Form der Anstösse und des Gehäuses erinnern an die letzten mechanischen Uhrenmodelle, die der Zürcher für Ventura erschaffen hatte, die legendäre „MyEgo“-Serie. Und dass sie in Glashütte seriös Uhren bauen können, beweisen die Menschen von Nomos seit Jahren aufs Neue.
Für eine Nomos ist die „Zürich“ mit ihren 40 mm Durchmesser eine grosse Uhr. Dank ihrer feinen Lunette wirkt sie eher noch etwas grösser als andere Uhren dieses Formats. Das klassisch-elegant gestaltete Zifferblatt mit seinen aufgesetzten rhodinierten Indexen ist ein Musterbeispiel von Aufgeräumtheit. Alles ist perfekt an seinem Platz, kein Detail zu viel, keine Information zu wenig. Ein echter Wettstein. Das Zifferblatt gibt es in vier Farbvarianten: Nomos-klassisch weiss versilbert oder anthrazitfarben, oder in braungold oder blaugold galvanisiert, mit einem sehr effektvollen Strahlenschliff. Das Ganze mit oder ohne Datum, mit den entsprechenden Nomos-Werken Zeta beziehungsweise Epsilon, beide mit automatischem Aufzug und bestens bekannt und bewährt aus dem Tangomat.

Ulysse Nardin: Marine Chronometer Manufacture
30.03.2012Jahre wurde an seiner Entwicklung gearbeitet. 2011 wurde es an der Baselworld vorgestellt. Und jetzt erscheint die erste Armbanduhr von Ulysse Nardin mit dem lange erwarteten Kaliber UN-118. Standesgemäss in Form eines Marine Chronometers.
Die Marine-Kollektion ist bei Ulysse Nardin seit Jahren ein sicherer Wert und steht für elegante Uhren, die gleichzeitig dank ihrer Wasserdichtigkeit für jede Lebenslage geeignet sind. Nun kommt die neueste Ergänzung der erfolreichen Serie, und wie.
Marine Chronometer Manufacture heisst die Uhr, in einem 45 mm grossen Gehäuse aus 18 Kt. Roségold. Sie ist die legitime Hommage an die Vergangenheit von Ulysse Nardin, die ihre erste weltweite Berühmtheit dem Bau von Deckschronometern verdankt. Über die Entwicklungen bei Ulysse Nardin haben wir an dieser Stelle schon oft berichtet. Im neuen Manufakturkaliber UN-118 fliessen nun sehr viele Erfindungen und Erfahrungen der innovativen Firma aus Le Locle ein. Massgebend sind die eigene Hemmung aus DiamonSil-Teilen und die patentierte Unruhe mit einer Siliziumspirale. Von hohem Alltagsnutzen ist sicherlich die Datumsschnellkorrektur, die vorwärts und rückwärts gedreht werden kann (wie man das aus den GMT Big Date-Modellen von Ulysse Nardin schon länger kennt). Und ganz schön praktisch ist die hohe Gangreserve von rund 60 Stunden. Wie es sich gehört, ist das Werk von der C.O.S.C chronometerzertifiziert.
Besonders ist auch das Zifferblatt dieser Schönheit. Ulysse Nardin hat 2011 im Sinn einer Nachfolgereglung ihren langjährigen Lieferanten Donzé Cadrans in Le Locle übernommen. Diese Firma ist wegweisend in der Herstellung von Emaille-Zifferblättern, besonders in der berühmten, enorm aufwändigen Technik des émaille cloisonné. Für die limitierte Serie stellten die Emaille-Künstler nun ein dreiteiliges Zifferblatt in reinem Weiss her, wundervoll detailreich gefertigt.
Für diejenigen, die bei den 350 Stück leer ausgehen gibt es die unlimitierte Version in einem Titan-/Stahlgehäuse mit eine schwarzen Zifferblatt, wahlweise auch mit einer Goldlunette. Die inneren Werte sind dieselben.
Die technischen Daten:
Gehäuse: ø 45 mm, in Rotgold (limitierte Serie) oder Titan/Edelstahl, verschraubte Krone, Saphirglas auf Vorder- und Rückseite
Wasserdichtigkeit: 20 atm (200 Meter)
Werk: Manufakturkaliber UN-118, 50 Steine, Patentierte Hemmung und Unruhe, Siliziumspirale
Gangreserve: ca. 60 Stunden
Schade nur, dass der 2011 verstorbene Firmenpatron Rolf Schnyder diese Uhr nicht mehr erleben durfte. Sie ist eines seiner vielen Vermächtnisse.

Qlocktwo W – Zeit in Worten jetzt auch fürs Handgelenk
28.03.2012Als Weltpremiere präsentierte das deutsche Gestalterduo Biegert & Funk an der Baselworld 2012 mit der Qlocktwo W eine vollkommen neuartige Armbanduhr. Ein echter Kontrapunkt zur traditionellen Uhrmacherei, die in Basel dominiert.
Nach dem grossen Erfolg mit der Wanduhr Qlocktwo und der Tischuhr Qlocktwo Touch war es absehbar, dass das geniale und verblüffende Prinzip der „Zeit in Worten“ auch in Form einer Armbanduhr umgesetzt würde. Die Frage war nur, ob das überhaupt technisch und ästhetisch machbar sein würde. Die Qlocktwo W liefert nun den Beweis, dass das Konzept auch am Handgelenk stimmt, und dies sehr überzeugend.
Der Grundaufbau ist bei der gesamten Qlocktwo-Familie derselbe: Auf den ersten Blick sichtbar ist eine Matrix aus 110 Buchstaben, die nicht sofort einen Sinn ergeben. Durch das richtige Ansteuern leuchten die im Hintergrund montierten LED und zeigen Wörter an, um die Zeit in Fünf-Minuten-Schritten zu beschreiben. Für die minutengenaue Anzeige dienen vier kleine Punkte unterhalb der Zeichen. „Es ist fünf vor sieben“ heisst es dann beispielsweise.
Die Grundform der Qlocktwo W ist quadratisch, so wie bei den grösseren Vorbildern. Mit dem äusserst flachen, 35 x 35 mm grossen, fein satinierten Stahlgehäuse mit Saphirglas macht sie auch auf feinen Handgelenken eine gute Figur. Zum Leben erweckt wird sie per Knopfdruck, wie man das von den allerersten Digitaluhren mit den roten LED-Schriften kennt. Über den Drücker werden auch die weiteren Funktionen wie Datums- oder Sekundenanzeige aufgerufen.
Das Design ist schlicht und modern. Dank seiner klaren Reduktion aufs Wesentliche wird es sämtliche Moden überdauern – die Uhr hat, wie ihre beiden grösseren „Vorfahren“, das Potential zum echten Klassiker. Qlocktwo und Qlocktwo Touch wurden seit ihrem Erscheinen weltweit mehrfach preisgekrönt. Man kann davon ausgehen, dass dies auch bei der Qlocktwo W der Fall sein wird. Auch sie wird nicht nur bei Design-Aficionados eine grosse Fangemeinde finden, sondern auch bei Menschen mit einem Hang zur Poesie und einem differenzierten Zugang zur Zeit.
Die Reaktionen in Basel waren überaus positiv. Selbst Uhrmacherlegenden wie Laurent Ferrier, aber auch viele Brancheninsider zeigten sich vollkommen neidfrei begeistert vom Konzept der beiden deutschen Newcomer.
Die Qlocktwo W wird ab Herbst 2012 in verschiedenen Varianten zu Preisen ab CHF 770.- auf den Markt kommen. Zur Auswahl stehen ein satiniertes oder ein poliertes Edelstahlgehäuse sowie ein satiniertes mit zusätzlicher schwarzer PVD-Beschichtung. Armbänder werden in Leder oder Kautschuk verfügbar sein. Die Qlocktwo W wird es vorerst in den Sprachen Englisch, Deutsch und Französisch geben, weitere Sprachversionen sind vorgesehen.

Noch ein Meilenstein von Seiko: Die Astron GPS Solar
21.03.2012Das ist die perfekte Uhr zur Globalisierung. Die neue Seiko Astron GPS Solar ist die erste, die ein GPS-Signal dafür nutzt, die Zeit in allen 39 existierenden Zeitzonen richtig anzuzeigen, an jedem Ort der Welt also. Für Piloten, echte Jetsetter und Weltumrunder, und nicht zuletzt für Technikbegeisterte.
Der Name Astron ist Kennern der Uhrenhistorie ein Begriff. Seiko präsentierte 1969 unter dem Namen die erste Serienarmbanduhr der Welt mit einem Quartzwerk. Sie wurde mittlerweile sogar in der Liste der IEEE-Meilensteine aufgenommen. Diese wird vom renommierten Institute of Electrical and Electronics Engineers publiziert und enthält so bahnbrechende Erfindungen wie den ersten transkontinentalen Telegraphen, Marconis Experimente oder Thomas Edisons Arbeiten. Über die Meriten von Seiko in der Weiterentwicklung der Quarzuhrentechnik haben wir an dieser Stelle schon mehrmals berichtet. Die letzten Meilensteine waren die E-Ink-Displays und die Uhren mit Spring Drive-Technik.
Um Uhren mit Zeitsignalen zu synchronisieren, war bis anhin der Empfang eines der existierenden Funksenders notwendig, wie beispielsweise dem DCF-Sender in der Nähe von Frankfurt. Seiko hat mit dieser Technik viel Erfahrung, und auch die E-Ink-Uhr aus dem Jahr 2010 nutzt sie. Doch diese Signale sind längst nicht überall auf der Welt verfügbar.
Von der Fachwelt völlig unerwartet (und als Geheimnis mindestens so gut gewahrt wie ein neues Produkt von Apple) zog der japanische Gigant nun an der Baselworld 2012 eine Astron aus dem Hut, mit absolut bahnbrechender Technik. Astron GPS Solar heisst das brandneue Modell, das in einem stattlichen Titangehäuse mit 47 mm Durchmesser daherkommt. Allerdings täuscht die Grösse – die Uhr ist dank des verwendeten Gehäusematerials sehr leicht und damit angenehm am Handgelenk zu tragen.
Den geschichtsträchtigen Namen Astron hat sich die Uhr wohl verdient. Herzstück der Uhr ist ein über Jahre vollkommen neu entwickeltes Werk, das einen extrem miniaturisierten Empfänger für GPS-Signale enthält. Dieser zeichnet sich vor allem auch dadurch aus, dass er extrem wenig Strom verbraucht. Nicht weniger als hundert Patente sind in der Uhr enthalten. Die Stromversorgung erfolgt mittels Solartechnik über ein lichtdurchlässiges Zifferblatt.
Um die Datenmenge minimieren zu können, haben die Ingenieure von Seiko die Welt in rund 1’000’000 Sektoren aufgeteilt. Von jedem dieser Orte sind die Koordinaten und die anzuwendende Zeitzone bekannt. Einmal täglich oder auf Knopfdruck stellt sich die Astron nun an jedem Ort der Welt auf die lokale Zeit ein. Wer den Himmel sieht, hat genaue Zeit – so einfach kann das Leben des Reisenden jetzt sein.
Problematisch sind ja nicht die geographisch definierten Zeitzonen, sondern diejenigen, die aus politischer Motivation eingeführt wurden. Wie beispielsweise vom venezolanischen Revolutionscaudillo Hugo Chavez, der mit einer halbstündigen Verschiebung Distanz zum Erzfeind USA symbolisieren wollte. Oder in Nepal, wo mit UTC + 5:45 h eine noch bizarrere Differenz angewandt wird – dies, um sich vom grossen Nachbar Indien abzugrenzen.
Dafür liest die Astron das Signal von vier oder mehr Satelliten aus, die in ihrem Sichtbereich sind. Damit die Ortung mit GPS-Signalen funktioniert, müssen die Satelliten sowieso über die höchst präzise Atomzeit verfügen – sie sind also eine dauernd verfügbare Quelle für genaueste Zeit. Aber auch ohne Satellitenempfang verspricht Seiko eine Genauigkeit von +/- 15 Sekunden pro Monat. Und wer die Angaben von Seiko kennt, weiss, dass hier immer eher tief gestapelt wird. Selbstverständlich korrigiert die Astron auch das Datum automatisch – und das bis ins Jahr 2100.
Lanciert wird die Uhr in einer kompletten Kollektion in verschiedenen Varianten. Allen gemeinsam ist das Titan- oder Stahlgehäuse mit einem Saphirglas mit einer beidseitig angebrachten Seiko-eigenen „Super-Clear“-Antireflexbeschichtung, die 99% der Lichtreflektion absorbieren soll. Speziell ist auch die kratzfeste Keramiklunette. Das Flaggschiff SAST001 ist die auf weltweit 2500 Stück limitierte Lancierungsserie im Gehäuse mit einer schwarzen Karbonbeschichtung, das sich zudem über besonders aufwändig gemachte Flanken auszeichnet. Das bestechend dreidimensionale Zifferblatt mit seinen aufgebrachten Stundenringen, und der markanten Skala für die Anzahl empfangener Satelliten, die Sommerzeit, den Flight Mode und die Gangreserveanzeige besticht durch seine Verarbeitungsqualität. Markant sind die satt mit Leuchtmasse versehenen Stundenindexe, die mit der Innenlunette verbunden sind, auf der bei der die weltweit 24 Zeitzonen mit Flughafenkürzeln angebracht sind. Bei der 6-Uhr-Position wird die Heimat- oder Referenzzeit angezeigt, mit einer kleinen 24-Stunden-Uhr. Wasserdicht sind die neuen Astron bis 10 bar.
Die unlimitierten Varianten haben Gehäuse in Titan mit mit Titan- oder Silikonband (SAST003 / SAST005) oder in Stahl mit Stahlband. Die Uhren kommen im Herbst 2012 auf den Markt, voraussichtlich zu Preisen zwischen 2600 und 4400 Schweizer Franken.
Uhrsachen konnte sich wenige Exemplare der limitierten Startserie sichern.

Armin Strom Racing-Uhren: Von der Boxengasse ans Handgelenk
09.09.2011Zugegeben: Die Idee, aus speziellen Materialien Uhrwerksbestandteile zu machen, ist nicht absolut neu. Doch weil die Firma Armin Strom eine richtige Manufaktur ist, in der auch Späne fliegen, konnte sie mit sehr viel Konsequenz umgesetzt werden. Hintergrund ist ein Formel-1-Sponsoringengagement der aufstrebenden Bieler Firma.
„Wir hätten ja einfach ein Logo auf unsere Uhren machen können. Aber das war uns dann doch zu einfach“ schildert Claude Greisler, Produktentwickler und Konstrukteur bei Armin Strom den Grundgedanken zu einer besonderen Serie von Uhren. Ausgangspunkt war ein Sponsoringengagement von Armin Strom beim russisch-britischen Formel 1-Team Marussia Virgin Racing. „Ein Formel 1-Motor hält rund 40 Stunden, dann ist er hin. Ein Uhrwerk hält bei guter Pflege ewig. Diesen extremen Gegensatz wollten wir aufzeigen und umsetzen.“
Die Formel 1 produziert also grosse Mengen an Hightechschrott aus besten Materialien. Die Idee war rasch geboren, doch die Umsetzung sollte sich als knifflig erweisen. So ging erst einmal die Recherchiererei los. „Kein Problem, klar können wir Aluminium oder auch andere Legierungen schmelzen“ war jeweils die Antwort bei den angefragten Betrieben. „Mindestmenge ist 250 kg“ war der Nachsatz. „Wir haben viereinhalb Kilo“ erwiderte Greisler, womit die Sache jeweils gegessen war.
Nach langem Suchen wurde man in St. Gallen bei einer Kunstgiesserei fündig, die erstens einen Prototypen eines Vakuum-Ofens hat und zweitens nicht die Hände verwirft, wenn man mit kleinen Mengen ankommt. Sie zeigte viel Freude an der Idee und ging mit entsprechendem Engagement zur Sache. Die korrekte Verarbeitung ist entscheidend. „Gerade weil wir die Teile nachher spanabhebend bearbeiten, war es enorm wichtig, dass sie keinerlei Lufteinflüsse aufweisen. Diese würden nachher auf den gefertigten Teilen hässlich aussehen und uns zudem bei der Produktion Probleme verursachen“ ergänzt der Produktionschef.
Aluminium schmilzt bei der für Metalle verhältnismässig niederen Temperatur von rund 660º Celsius. Die flüssige Aluminium-Speziallegierung kommt aus dem Ofen und wird dann sorgfältig in Blöcke gegossen. Diese sind dann noch zu dick, um sie für die relativ dünnen Uhrenteile direkt verwenden zu können. Darum ist die nächste Etappe ein Walzwerk. Danach erfolgt die eigentliche Bearbeitung im Hause Armin Strom. Die äusseren Formen der Brückenteile für die Modelle One Week und Regulator aus der modernen „Armin“-Linie bleiben konstruktionsbedingt gleich. Ganz anders präsentiert sich hingegen die Oberfläche.
Gewichtsreduktion ist in der Formel 1 eines der obersten Gebote. Jedes Gramm kann sich zu einem Kilo summieren, und jedes Kilo zuviel kostet Millisekunden an Geschwindigkeit. Und nur um die geht es in der Königsklasse des Rennsports. Darum wird bei vielen Teilen alles weggefräst, was irgendwie verzichtbar ist. „Eigentlich sind wir hier gar nicht so weit von Armin Stroms Urkompetenz entfernt, dem Skelettieren. Obwohl es dort natürlich ästhetische Gründe sind, und nicht die Gewichtsreduktion zählt“, sagt CEO Serge Michel mit einem Augenzwinkern.
Durch die Anwendung dieser Gestaltungselemente erhalten die gefertigten Spezialteile einen richtig technischen Look. Dieser wird noch vom Aussehen des Materials unterstützt. Die Bearbeitung der Teile war indessen eine grosse Herausforderung. Das Material wird in der Uhrenbranche eher selten verwendet. Es ist sehr heikel, es mit den gewohnten Werkzeugen zu fräsen. „Wir haben viel geübt“ sagt Greisler mit rollenden Augen. Doch Aufgeben ist nicht in der DNA dieses ausdauernden Schaffers, und so fand er letzlich einen Weg, das Material adäquat zu verarbeiten und sie dann auch perfekt in die von ihm gestalteten Werke zu integrieren.
Das Resultat kann sich mehr als sehen lassen. Die Manufakturwerke bestechen bereits in der herkömmlichen Ausführung durch ihren eigenständigen, charaktervollen Auftritt. Das gekonnte Spiel mit den Materialien und der Einsatz der Marussia-Virgin-Teamfarben rot und schwarz geben den Uhren ein unverwechselbares Aussehen. Entsprechend vielversprechend sind die Eingänge an Bestellungen, und dies nicht nur aus dem Umfeld des Formel-1-Teams, sondern auch von Kunden, denen die Racing-Komponente der Uhren einfach sehr gut gefällt.
Die Kollektion umfasst insgesamt vier verschiedene Modelle. Auf der „Pole Position“ steht unbestritten die Armin Racing One Week mit dem 2010 vorgestellten Handaufzugs-Manufakturwerk mit seinen sieben Tagen Gangreserve. Sie ist auf 40 Exemplare limitiert – dies vor allem wegen des sehr aufwendigen Herstellungsprozesses. Im selben, mit mattschwarzer PVD-Beschichtung behandelten Gehäuse gibt es das auf 100 Stück limitierte Modell Racing Regulator mit seiner typischen dezentrierten Anzeige und der markanten retrograden Datumsanzeige. Etwas herkömmlicher sind die beiden Racing Chronographen, die ganz in den Marussia-Virgin-Farben gehalten sind. Sie werden vom bewährten Valgranges-Automatikwerk angetrieben und insgesamt genau 500 mal hergestellt.
Was jetzt in der ganzen Angelegenheit noch fehlt, ist ein wenig mehr Erfolg und Rennglück des noch jungen Marussia-Virgin-Teams. Die beiden Piloten Timo Glock und Jerome D`Ambrosio fahren dem Feld zur Zeit noch hinterher. An den Uhren des Teams dürfte dies nicht liegen, sie sind absolut auf der Höhe der Zeit. Gemeinsam ist den Crews von Armin Strom und von Marussia-Virgin die Dynamik und der Wille, es nach vorne zu schaffen. Wir sind gespannt.

Vogard Datezoner: Die Zeitzonen im Griff, inklusive Datum
09.09.2011Das Vogard-System, mit dem man die Zeitzone über einen einfachen Dreh der Lunette einstellen kann, ist an sich schon sehr schlau. Jetzt setzt Vogard-Chef Mike Vogt noch einen drauf: Der Datezoner bezieht auch noch das aktuelle Datum in die Anzeige mit ein, dank eines technischen Kniffs erster Güte.
Nicht weniger als „die Referenz von mechanischen Weltzeituhren zu werden“ hat sich der Gründer, Inhaber und „Créateur“ von Vogard als Ziel gesetzt. Mike Vogt verfolgt dieses Ziel unermüdlich, sowohl im Atelier als auch bei seinen ausgedehnten Touren rund um die Welt. Sein Ansatz, dass man nicht zwei Zeitzonen aufs Mal auf einer Reiseuhr ablesen können muss, sondern dass eine reicht, wenn man sie sehr einfach verstellen kann, prägt bereits die bestehende Kollektion. Typisch ist der markante Hebel, den man öffnet und auf diese Weise die Drehlunette freigibt. Mit ihr stellt man die Zeit der auf der Lunette angegebenen Städte und Destinationen ein.
Was Vogt allerdings daran noch nicht befriedigte, war der Umstand, dass das Datum nicht berücksichtigt wurde. Dieses Problem löst jetzt der Datezoner. Die Datumseinstellung erfolgt bei dieser Uhr über den Drehring und ist gleichzeitig gekoppelt mit der jeweiligen Zeitzone und der Stadt auf dem Drehring. Der neue und einzigartige Mechanismus ist patentiert und ermöglicht, dass beim Drehen des Stundenzeigers über die Mitternachtslinie das Datum automatisch vorwärts oder rückwärts springt und somit in jeder Zeitzone exakt das richtige Datum anzeigt. Wichtig ist dabei, dass man in die richtige Richtung dreht, aber dafür sind die Indikationen West/Ost da. Respekt.
Das grosse Datumsfenster ist bei der 6-Uhr-Position angebracht. Durch seine Grösse erlaubt es eine zweizeilige Anzeige und damit eine sehr gute Ablesbarkeit des Datums. Oberhalb des Datumsfensters ist zusätzlich eine Tag-/Nachtanzeige eingebaut, im Gegensatz zum 24-Stunden-Zeiger bei den bisherigen Vogard-Uhren. Dadurch wird die Uhr eindeutig übersichtlicher.
Das Synchronisationsrad
Die Verbindung der Zeitzone mit einer Datumsschaltung ist ein echtes Novum. Basis der genialen Lösung bildete die Entwicklung eines in einer schiefen Ebene liegenden Synchronisationsrades, welches vom Zeitzonenwerk angetrieben wird und jeweils eine der 31 winzigen Noppen unter der Datumsscheibe ansteuert. Knifflig war dabei die Berechnung des exakten Winkels für die Positionierung des Synchronisationsrades in der schiefen Ebene. Tatkräftige Unterstützung erhielt die findige Vogard-Crew von niemand geringerem als AHCI-Mitglied Andreas Strehler, der als einer der begnadetsten Uhrmacher und Entwickler unserer Zeit gilt und auch für ganz Grosse in der Branche arbeitet. Der revolutionäre Mechanismus setzt fürs Funktionieren sehr enge Toleranzen in der Fertigung voraus, die im Hunderststel-Millimeter-Bereich liegen. Nur wenn alle Teile diese Präzision aufweisen, schaltet das Datum exakt um einen Tag vor- und vor allem auch wieder rückwärts.
Für die Fertigung der Komponenten arbeitet Vogard unter anderem mit einem Hersteller von Aviatikinstrumenten zusammen, denn auch in der Luftfahrt gelten höchste Anforderungen an die Toleranzen. Die Uhren werden in verhältnismässig kleinen Stückzahlen produziert, die Montage erfolgt ausnahmslos in den eigenen Ateliers in Nidau bei Biel.
Selbstverständlich integriert der Datezoner auch die anderen, bewährten Merkmale der Vogard-Kollektion, also die – ebenfalls patentierte – Anzeige der Sommerzeit als auch die Möglichkeit, einen personalisierten Drehring mit den Städten seiner Wahl gravieren zu lassen.
Design-Inspiration vom Armaturenbrett
Die typische Anordnung von Tourenzähler und Tacho bei Sportwagen stand Pate beim Design und bei der Materialisierung des Karbon-Zifferblatts. Der Minuten- und der Stundenzähler sind auf einer separaten Platte angeordnet, die markant mit Schrauben fixiert sind. Sie ermöglichen ein intuitives und logisches Ablesen der gestoppten Zeit, von links nach rechts zuerst die Stunden, dann die Minuten und mit dem zentralen grossen Zeiger die Sekunden. Die Scheibe für die laufende Sekunde der Uhr ist bei 12 Uhr angeordnet und rückt auf diese Weise etwas in den Hintergrund.
Speziell ist auch die Anordnung der Bedienungselemente. Diese wird notwendig wegen des Hebels, der die Drehlunette freigibt. Die Drücker für Start und Stopp befinden sich darum ungewohnterweise bei 4 beziehungsweise 8 Uhr. Sie sind sehr griffig und damit gut zu bedienen, selbst mit Handschuhen, da man zum Starten des Chronographen sehr gut den Daumen benutzen kann. Also auch beim Fahren oder Fliegen. Die Krone, die man bei einer automatischen Uhr im Alltag eher selten benötigt, ist bei 6 Uhr angebracht und ins Band integriert.
Der Datezoner ist mit 48 mm Durchmesser eine grosse und hoch gebaute Uhr, was mit den verwendeten Komplikationen zusammenhängt. Dennoch liegt er gut am Arm. Die Proportionen stimmen und durch die Verwendung von Titaniumcarbid (TiC) als Gehäusematerial hält sich auch das Gewicht in einem vernünftigen Rahmen. Das Material sorgt für eine schwarze Oberfläche und unterstreicht den sportlichen Gesamteindruck. Mit einem Härtegrad von 900 Vickers hat es zudem eine rund dreimal höhere Abriebfestigkeit als herkömmliches Titanium.
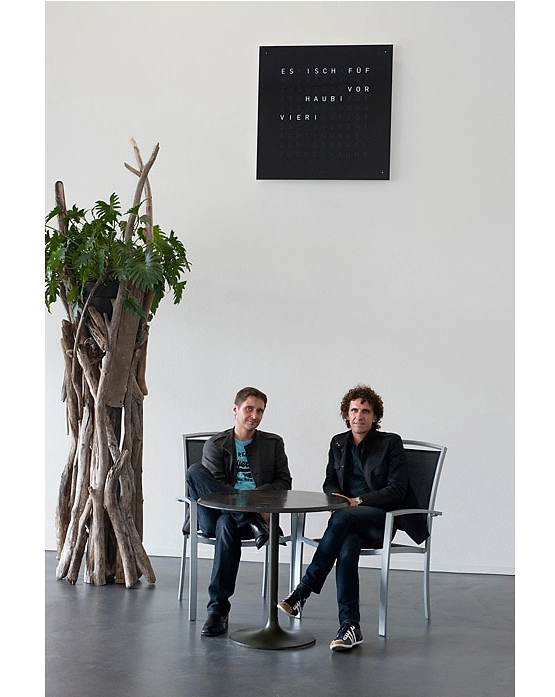
Weltpremière in Thun: Die Qlocktwo Large
24.08.2011Die mehrfach preisgekrönte Wand- und Standuhr Qlocktwo zeigt die Zeit in Worten an. Das neu eröffnete Kultur- und Kongresszentrum Thun hat nun das Privileg, die weltweit erste Grossversion der Qlocktwo zu besitzen. Natürlich in der berndeutschen Version. Es isch füf vor Zwöufi.
Selten war ein neues Produkt auf Anhieb so erfolgreich wie die vor zwei Jahren lancierte Wanduhr Qlocktwo des deutschen Gestalterduos Biegert & Funk. Das Prinzip der Qlocktwo basiert auf einer Matrix mit symmetrisch angeordneten Schriftzeichen. Einige dieser Zeichen leuchten in reinem Weiss und formen so Worte, welche die Zeit geradezu poetisch beschreiben.
Für den öffentlichen Bereich wurde nun eine 90 x 90 cm grosse Version der Qlocktwo entwickelt. Die weltweit erste davon hängt seit einigen Tagen im grosszügig gestalteten Foyer des KK Thun, perfekt passend zu der hochwertigen modernen Architektur.
Die grosse Version übernimmt die bewährten Eigenschaften der herkömmlichen Qlocktwo: Die Frontfläche ist aus poliertem Plexiglas. Die Anzeige ist dank Funksteuerung stets sekundengenau und passt sich Sommer- und Winterzeit automatisch an. Im Hintergrund arbeiten sagenhafte 456 LED, langlebig und äusserst stromsparend.
Die Qlocktwo Large wird auf Kundenbestellung hergestellt, sie ist in verschiedenen Standardfarben lieferbar, aber auch in einer Wunschfarbe. Verfügbar sind mehr als 13 Sprachen.

Qlocktwo Touch: Poetisch wecken
24.08.2011Nach dem grossen Erfolg der Wand- und Standuhr Qlocktwo folgt nun die kleinere Variante, mit Weckfunktion. Auch die Qlocktwo Touch zeigt die Zeit in Worten an.
Selten war ein neues Produkt auf Anhieb so erfolgreich wie die Wanduhr Qlocktwo des deutschen Gestalterduos Biegert & Funk. Weltweit wurde das überaus innovative Produkt mit Designpreisen ausgezeichnet, und auch in der Schweiz ist sie sehr beliebt.
Das Prinzip der Qlocktwo basiert auf einer Matrix mit symmetrisch angeordneten Schriftzeichen. Einige dieser Zeichen leuchten in reinem Weiss und formen so Worte, welche die Zeit geradezu poetisch beschreiben. Es ist zwanzig nach Zehn, es ist fünf vor Zwölf.
Qlocktwo Touch heisst die neue Version, sozusagen die kleine Schwester. Das unwiderstehliche Zeitobjekt hat ein elegantes Monobloc-Gehäuse aus silberfarben oder schwarz eloxiertem Aluminium. Die Dimensionen des Quadrats von 13,5 cm sind perfekt.
Wie beim grossen Vorbild besteht auch bei der „Touch“ die Frontfläche aus poliertem Plexiglas. Sie wird mit Magneten auf der Grundplatte fixiert und kann darum ganz einfach ausgewechselt werden. 7 ausgesuchte Farben stehen zur Wahl.
Die Qlocktwo Touch ist in den meisten europäischen Standardsprachen lieferbar, selbst in einer berndeutschen Version.

EPD-Anzeige: Die Schärfste, von Seiko
03.06.2011Seiko hat im Bereich der Digitaluhren immer wieder die Pionierrolle innegehabt.
Unvergessen sind die ersten digitalen Multifunktionsuhren, die es in den siebziger Jahren sogar ans Handgelenk von James Bond geschafft hatten. Jetzt kommt aus Japan die erste Uhr mit Aktivmatrixdisplay – mit einer sensationellen Schärfe der Anzeige.
1975 schrieb der japanische Uhrenkonzern Seiko Geschichte mit der Lancierung der ersten digitalen Multifunktionsuhr mit LCD-Anzeige. Und 1977 wurde der legendäre Roger Moore als James Bond in „Der Spion der mich liebte“ von einer Message aus dem Hauptquartier, die aus seiner digitalen Seiko-Uhr tickerte, beim Schäferstündchen mit der betörenden russischen Majorin Anya Amasova (Agent XXX) gestört.
Diese frühen Seiko-Digitaluhren kosteten damals richtig Geld und sind heute sehr gesuchte Sammlerstücke, wenn sie – was leider selten ist – noch in einem guten Zustand sind.
Nun kommt der Nachfolger, mit der aktuellsten Technik von heute:
Die Seiko SDGA001 mit EPD-Anzeige
Seikos Innovationen gingen weiter. 1982 war es die erste Fernseh-Uhr der Welt, die für Staunen sorgte. Allerdings musste man zu der Uhr einen reichlich unförmigen Fernsehempfänger mitschleppen, der per Kabel an die Uhr angeschlossen wurde. Der kommerzielle Erfolg dürfte sich im Rahmen gehalten haben. Auch die erste Digitaluhr mit eigentlichen Computerfunktionen, die erste mit Sprachaufnahmemöglichkeit und der erste Tauchcomputer gingen aufs Konto der findigen Ingenieure. 2006 präsentierten sie dann in Basel die erste Uhr mit einem Display mit elektronischer Tinte, eine sehr avantgardistische Spangenuhr mit futuristischer Anzeige. Diese gewann – ausgerechnet im Epizentrum der noblen Uhrenindustrie – auf Anhieb den prestigeträchtigen Grand Prix d`Horlogerie de Genève.
EPD heisst das Zauberwort dieser neuen Technologie, das für Elektrophoretisches Display steht und die Wanderung elektrisch geladener Teilchen durch einen als Trägermaterial dienenden Stoff in einem elektrischen Feld bezeichnet. Tönt kompliziert, ist es auch. Diese Technologie wird beispielsweise auch bei den E-Book-Lesegeräten genutzt.
Zwei Dinge sind auf den ersten Blick frappant: Die unglaubliche Schärfe der Anzeige, die aus der Auflösung von 300 dpi (dots per inch, also Punkte pro Zoll) resultiert, so wie man sich das von Laserdruckern gewohnt ist. Das zweite ist der Blickwinkel. Selbst aus fast 180° sind die Zahlen noch perfekt ablesbar.
Gespiesen wird die neue Uhr über kleine Solarzellen, die rund um die Anzeige diskret angebracht sind. Dank der neuen Technologie braucht das Display aber nur sehr wenig Strom, nämlich nur dann, wenn etwas auf der Anzeige ändert (siehe Erklärung im Schema). Die präzise Quarzuhr empfängt die Signale von 4 Funkstationen (Deutschland, Grossbritannien, USA und Japan). An Zusatzfunktionen bietet sie einen Alarm sowie vor allem eine umfangreiche Weltzeiteinstellung, in der auch spezielle Halbstunden-Zeitzonen berücksichtigt werden.
Fast unbeschränkt sind die Gestaltungsmöglichkeiten der Anzeige, da man nicht mehr auf die herkömmlichen LCD-Segmente angewiesen ist. Nicht nur zwischen positiver und negativer Darstellung hat man bei der Uhr die Wahl. Beim Worldtimer ist beispielsweise eine kleine Weltkugel zu sehen, auf der der eingestellte Ort hervorgehoben wird. Auch eher abenteuerliche Designs können ausgewählt werden, die den Geschmack hier nicht unbedingt treffen dürften.
Einen Nachteil hat die Technik allerdings noch. Die Mikro-Partikel benötigen eine gewisse Zeit, um sich in den Kapseln umzuschichten (siehe Illustration), dadurch ist die Anzeige etwas träge und eignet sich (noch) nicht für bewegte Bilder. Ein mitlaufender Chronograph oder ein analog abgebildeter Sekundenzeiger wäre eine mögliche solche Anwendung. Aber wir sind uns fast sicher, dass die findigen Seiko-Techniker auch das noch in den Griff bekommen werden.
So funktioniert die E-Tinte:
Das Prinzip der E-Tinte: Kleine Kapseln (Illustration unten – Durchmesser: ca. 50 Tausendstelmillimeter) sind mit tausenden mikroskopisch winzigen negativ geladenen weissen und positiv geladenen schwarzen Partikeln gefüllt, die in einer klaren Flüssigkeit liegen. Wenn ein positives oder negatives elektrisches Feld erzeugt wird, bewegen sich entsprechend die weissen oder die schwarzen Partikel nach oben. Resultat ist ein weisses oder schwarzes Pixel. 80`000 solche Pixel bilden das Display der neuen Uhr von Seiko. Der Strom muss immer nur dann fliessen, wenn die Anzeige ändert, dadurch ist die Technik unerreicht energiesparend.

Die mechanische Uhr fürs iPhone
26.05.2011An der Baselworld 2011 zeigte der im Luxussegment tätige Hersteller De Bethune ein sehr schickes Etui fürs iPhone mit einer integrierten mechanischen Uhr. Nobel, aber teuer. Jetzt war am EPHJ in Lausanne ein interessantes Konzept für einen iPhone-Halter mit integrierter mechanischer Uhr zu sehen.
Luc Pellaton ist eigentlich Ingenieur und nicht Uhrendesigner. Nun wagt er sich aber auf besondere Weise in diesen Bereich vor. WATCHe heisst das Konzept, das er am alljährlichen Salon der Uhrenzulieferer mit dem unförmigen Kürzel EPHJ in Lausanne dieses Jahr vorstellte. Es handelt sich um einen Rahmen aus in verschiedenen Farben eloxiertem Aluminium, in den man das iPhone 4integrieren kann. Dieser Rahmen verfügt über einen reichlich raffinierten Klappmechanismus, mit dessen Hilfe das ganze Ensemble auf verschiedene Arten aufgestellt werden kann.
Im Aufklapprahmen ist eine mechanische Uhr integriert. Es ist ein ETA-Standardwerk, das aber je nah Variante mehr oder weniger verändert wird. Gelungen ist ihm – nach unserer Meinung – die Übernahme der Formensprache des Kultteils von Apple. Die Gestaltung des Werks ist ebenfalls passend.
Weil Apple sich als relativ heikle (und eher humorlose) Firma zeigt, wenn es um Bilder ihrer Produkte geht, die man mit einem anderen, womöglich eigenen Produkt kombiniert, sind die folgenden Bilder immer ohne das iPhone gemacht.
Wie uns Luc Pellaton erklärte, ist er auch in den Startlöchern, es dann an das kommende iPhone 5 anzupassen, das innert – wie üblich bei Apple – noch unbekannter Frist vorgestellt werden wird.

Ikepod Hourglass: Das Stundenglas von Marc Newson
09.04.2011Der Australier Marc Newson gilt als einer der einflussreichsten und kreativsten Designer unserer Zeit. Es gibt kaum ein Objekt, dem sich der Tausendsassa nicht schon angenommen hätte – Flugzeuge, Fahrräder, Sessel, Innenarchitektur, Haushaltsobjekte. Unter der Marke Ikepod lancierte er um die Jahrtausendwende eine viel beachtete Uhrenkollektion. Jetzt bringt Ikepod eine umwerfende Neuinterpretation eines alten Themas: Das Stundenglas.
Seine Auszeichnungen kann er schon gar nicht mehr zählen, und das Time Magazine wählte ihn zu einer der einflussreichsten Personen unserer Zeit. Kleider für G-Star, Pfannen für Tefal, Sonnenbrillen für Lanvin, extracoole Slipper für Nike, ein Champangerkoffer für Dom Perignon, das Geschirr für die Airbus A380 von Quantas. Die Aufzählung umfasst nur einen winzigen Teil seines Schaffens (verschaffen SIe sich selber einen Überblick auf www.marcnewson.com). Natürlich durften da auch die Uhren nicht fehlen – jeder gute Designer hat irgendwann das Bedürfnis, sich auch an der Darstellung der Zeit zu versuchen. Ikepod hiess die Marke, die seinerzeit schöne Erfolge verzeichnen konnte. Leider hielten die Managementfähigkeiten bei Ikepod (Oliver Ike hiess der nicht durch Bescheidenheit glänzende deutsche CEO) nicht Schritt mit Newsons überirdischem Design. Die Firma ging, wie man es höflich ausdrückt, „in die Insolvenz“, unter Hinterlassung eines ansehnlichen Scherbenhaufens bei vielen Zulieferern im Jura.
Name, Entwürfe und Ideen wurden dann 2006 von einem New Yorker Kunstsammler namens Adam Lindeman aufgekauft, und bald wurden wieder erste Uhren produziert und neue Modelle vorgestellt. An der Spitze waltet als CEO heute der umtriebige, sympathische Franzose Alexandre David, der seine Sporen während vielen in der Uhrenbranche abverdient hat. Basis für die Armbanduhren bildete immer noch das wunderschöne runde Gehäuse mit seinen organischen Formen. Dieses wurde jedoch im Gegensatz zu den Vorgängermodellen überarbeitet und verbessert. Megapode, Hemipode und Horizon heissen die Modelle, die jetzt wieder erhältlich sind. Als wirklich neues Modell wurde 2008 die Solaris vorgestellt, eine für heutige Verhältnisse eher kleine Uhr mit zwei Quarzwerken in einem Keramikgehäuse, die man beidseitig tragen kann.
Radikal neue Uhren präentierte Newson 2010. Für Jaeger-LeCoultre intrepretierte er die legendäre Atmos neu, als Atmos 566 (siehe folgendes Bild). Auch dieser Entwurf wurde sofort zur Ikone.
Der wahre Paukenschlag hingegen war das „Hourglass“. Jawohl, man kann die Sanduhr neu erfinden. Bereits der Begriff Sanduhr ist hier aber eigentlich falsch. Im Innern der mit enormem Aufwand aus einem Stück gemachten Stundengläser rieseln nämlich „Nanoballs“. Das sind kleinste Stahlkügelchen, die mit verschiedenen Metallen beschichtet werden. Das Kunstobjekt mit hohem Potential als Sammlerstück gibt es in zwei Grössen, einmal mit 60 Minuten und einmal mit 10 Minuten „Gangreserve“. Die grosse Version mit den vergoldeten Nanoballs ist exklusiv reserviert für „The Hourglass“, den wohl berühmtesten und weltbesten Retailer für verrückte Uhren mit Standort in Singapur. Dessen Gründer und Patron Michael Tay wurde mit seinem Konzept in der Branche zur Legende – er gilt als grosser Förderer der alternativen „Haute Horlogerie“. „Ich war absolut begeistert von der Idee und habe sofort für eine limitierte Serie zugesagt. Die übrigens praktisch ausverkauft ist“ verriet uns Tay anlässlich einer Begegnung an der Baselworld. Aber noch nicht komplett ausgeliefert, denn der Aufwand in der Produktion ist enorm.
Die Herstellung des Hourglass erfordert eine gigantische Maschinerie. Glas zu bearbeiten ist generell sehr anspruchsvoll und erfordert neben entsprechenden Installationen auch viel Erfahrung. Nach langem Suchen fand David in Basel einen Betrieb, der in der Lage war, Newsons Pläne umzusetzen. So kompliziert kann das doch nicht sein, ein Stundenglas herzustellen, könnte man meinen. Doch die Annahme ist falsch. Bis zu drei Tage dauert es, bis eines der Kunstwerke fertig ist.
Impressionen aus der Produktion:
Aus einem speziellen Glasrohr-Rohling entstehen sie in vielen Schritten. Die Temperatur im Produktionsgebäuse ist schweisstreibend. Das Rohr wird in eine grosse, schwere Maschine eingespannt, damit man es gleichmässig drehen kann. Mit Flamme und Fingerspitzengefühl wird das Teil langsam in seine Form gebracht. Zur „Abkühlung“ kommt es danach in einen 570 Grad heissen Ofen, damit sich die Form stabilisieren kann. Besonders kritisch ist die Grösse der Öffnung, durch die die Stahlkügelchen am Schluss rieseln sollen, denn sie bestimmt die Genauigkeit, die Gangdauer.
Nach dem ganzen Produktionsprozedere wird Newsons Signatur angebracht. Dann erfolgt die Füllung. Die „Feinregulierung“ erfolgt durch das Zugeben von mehr oder weniger Nanoballs. Am Schluss wird die kleine Einfüllöffnung mit einem Stück Silikon dicht verschlossen.
Der Effekt beim Drehen des „Hourglass“ ist phänomenal und poetisch. Die ersten Stahkügelchen treffen aufs Glas und hüpfen, das Geräusch ist fein und mystisch. Man kann gar nicht anders als zuschauen. Klar: Für die Zeitmessung ist das Hourglass heute nicht notwendig. Wie viele grossartige Entwürfe in der Uhrenbranche.
Die zeitphilosophische Komponente an der Sache macht den unglaublichen Reiz dieses Kunstwerks aus. Zehn Minuten oder (beim grossen Modell) eine Stunde innehalten, durchatmen, nachdenken, einfach dem Rieseln zuschauen. Aber auch für den Businessalltag ist es geeignet: Beispielsweise um im Sitzungszimmer die Beiträge auf zehn Minuten reduzieren. „Sie haben zehn Minuten, um mir Ihr Projekt zu präsentieren.“
Die Dimensionen des Newson’schen Objekts:
Kleines Modell: Höhe 150 mm, Durchmesser 125 mm, Gewicht 1,5 kg
Grosses Modell: Höhe 300 mm, Durchmesser 250 mm, Gewicht 9,6 kg
Das Hourglass ist bei Uhrsachen in mehreren Varianten zu besichtigen. Aber Achtung: Das Risiko, sich in das Objekt zu verkucken, ist sehr hoch!
Lassen Sie sich einstweilen von den folgenden Bildern aus der Produktion verzaubern.

Aufgerappelt: Digitalpionier Ventura meldet sich zurück
06.03.2011Lange war es still um die Firma Ventura. Trotz sehr innovativen Ansätzen und Produkten wie der ersten automatischen Digitaluhr und markanten Designs ging sie 2007 mit einigen Nebentönen in Konkurs, mitten im grossen Uhrenboom (Tick different berichtete).
Doch nun meldet sich Ventura-Gründer Pierre Nobs zurück, und das mit einem eigentlichen Paukenschlag. Er hatte Ende 2009 die Möglichkeit, die Markenrechte und die Uhren und Komponenten der Konkursmasse wieder zu erwerben. Damit konnten in einer ersten Phase noch bestehende Modelle produziert und verkauft werden, was für ein wenig Cashflow sorgte. Zudem fand er Investoren, die bereit waren, Kapital für neue Entwicklungen einzuschiessen.
Im Vorfeld der Uhrenmesse Baselworld präsentiert ventura ein neues, äusserst innovatives Modell namens Sparc MGS. MGS steht für Micro-Generator-System. Dieses besteht aus mehreren, mechanisch sehr anspruchsvollen Komponenten. Ein Rotor, wie man ihn aus einer mechanischen Armbanduhr kennt, wird durch die Bewegungen des Trägers in Schwingung versetzt. Diese Schwingungen spannen über ein Wechselgetriebe eine Federkonstruktion (ein so genanntes „Barillet“), die wiederum ihre Spannkraft rund 17’000 mal auf einen Mikrogenerator entlädt. Speziell daran ist, dass die Feder spiralförmig ist, im Gegensatz zu den sonst in Federhäusern verwendeten Aufzugsfedern. Dieser Generator sendet Stromfunken und lädt damit einen Akku. Damit ist die Stromversorgung des digitalen Multifunktions-Uhrwerks gesichert.
Das Ganze ist, wie immer bei Ventura, sehr modern verpackt. Das Gehäuse erinnert an die letzten Modelle der v-tec alpha-Serie, die noch von Hannes Wettstein entworfen wurden, dem leider 2008 verstorbenen grossartigen Designer und Gestalter. Charakteristisch war daran der „Wettstein-Knick“, der für eine sehr gute Ergonomie sorgte. Diesen Knick hat man nun neu interpretiert. Er ist aber nicht einfach Designelement, sondern unabdingbar für den Tragekomfort der neuen Uhr. Sie zeigt auf der unteren Hälfte das grosse Display, auf der oberen in einem Sichtfenster aus Saphirglas den drehenden Rotor. Die Uhr ist zwar gross, aber dank des Knicks sehr gut tragbar, wie sich der Schreibende selber überzeugen konnte. Und sie ist nicht weniger als ein echter Meilenstein in der Uhrenarchitektur.
Gleichzeitig lanciert Ventura die v-tec Alpha II. Ihr 2003 vorgestellter Vorgänger war, wie jetzt die sparc MGS, wegweisend. Sie führte damals das „Easy Scroll“-System ein, mit dem die Uhr über ein kleines Rad bedient wird. Damit war eine sehr intuitive Bedienerführung möglich geworden, mit Drehen und Klicken konnten sämtliche Funktionen wie Stoppuhr, Wecker, Countdown und zweite Zeitzone angewählt werden. In der neuen Generation kommt dieses Scrollrad wieder zum Einsatz. Es bedient jetzt ein völlig neues Modul, das von Ventura in Zusammenarbeit mit der Firma Dynatronics enwickelt wurde, einer renommierten Mikroelektronik-Spezialistin im zürcherischen Uster.
Die LCD-Anzeige ist, wie beim Vorgängermodell, zweizeilig. Allerdings wird jetzt in der oberen Zeile die Zeit viel grösser angezeigt, und die Zusatzfunktionen in der zweiten Zeile heben sich klar ab. Speziell ist die Typographie des etwas technoid „Twisted Nematic Field Effect LCD“ genannten Displays. Denn niemand geringerer als der legendäre Schriftenguru Adrian Frutiger hatte Nobs schon bei der Gestaltung der ersten Version der Digitalschrift geholfen. „Unsere Displays haben enorm viele LCD-Segmente, viel mehr als das bei herkömmlichen Anzeigen der Fall ist. Dadurch können wir viel schärfere und besser lesbare Zeichen bieten“ erklärt Nobs. Tatsächlich hebt es sich von den gewohnten LCD-Displays deutlich ab.
Ventura bietet sich jetzt eine echte Chance auf ein Comeback. Mit dem unbestrittenen Topmodell der neuen Kollektion, der Sparc MGS, wurde eine Uhr geschaffen, die echtes Kultpotenzial hat. Mit einem vorgesehenen Verkaufspreis von rund 4500 Schweizer Franken ist sie kein Schnäppchen – aber echte Avantgarde in Kleinserie hat ihren Preis. Es wartet jedoch noch ein relevantes Problem auf Nobs, mit dem sich auch andere Nischenmarken schwer tun: Die richtigen Händler zu finden, die in der Lage sind, solche Uhren auch an die Endkunden zu bringen. Denn das beste Produkt nützt nichts, wenn der Vertrieb nicht stimmt. „Wir setzen auf ein Händlernetzwerk, das besitzergeführt und angetrieben von persönlichem Einsatz ist, mit einer grossen Begeisterung für spezielle und speziell schöne Uhren“ sagt Nobs dazu. Wenn er diese in ausreichender Anzahl findet, könnte die „Phönix aus der Asche“-Geschichte für Ventura am Ende doch noch gut ausgehen.
Die Funktionsweise des Micro Generator Systems
Der Rotor (1) wird durch die Bewegungen des Trägers in Schwingungen versetzt. Über das Wechselgetriebe (2) werden die Schwingungen auf die Feder, auch Barillet genannt, (3) übertragen. Das Barillet treibt einen Mikrogenerator (4) an, der 17’000 mal am Tag mit Funken (den „Sparcs“) Energie generiert, die im Akku (5) gespeichert wird. Dieser Akku speist dann das Werk und damit auch das LCD-Display (6).

Seiko Ananta neu mit Mondphase
20.10.2010Für ein grosses Raunen sorgte 2009 die Präsentation der Ananta-Linie von Seiko. Es sollte die erste Linie im luxuriöseren Segment werden, die von Seiko auch in einigen gesuchten Geschäften weltweit vertrieben wird. 2010 folgten einige neue Modelle. Sie werden nach wie vor nicht in riesigen Stückzahlen hergestellt und sind darum nur beschränkt verfügbar. Jetzt haben wir eines der feinsten Stücke aus der neuen Kollektion erhalten: Die Ananta mit SpringDrive-Werk und Mondphasenanzeige.Das Werk mit der kryptischen Bezeichnung 5R67 ist eigentlich ein alter Bekannter: Es wurde bereits in den limitierten SpringDrive-Mondphasenuhren von 2007 und 2008 eingesetzt (Tick different berichtete).
Diese waren jeweils sehr rasch ausverkauft, nur ganz wenige Exemplare fanden den Weg an die Handgelenke von glücklichen Schweizer Besitzern (wie unter anderen der Schreibende). Bestechend ist die Verarbeitung und natürlich der sanfte Fluss des Sekundenzeigers dank der SpringDrive-Technik.
In der charakteristischen Form der Ananta-Modelle ist die Erscheinung noch spektakulärer. Das Gehäuse ist gross und schwer, doch dank der guten Ergonomie liegt es gut am Arm. Die Stahlverarbeitung ist einzigartig, die Übergänge zwischen polierten und gebürsteten Bereichen sind perfekt. Saphirgläser auf Vorder- und Rückseite des bis 10 bar wasserdichten Gehäuses sind in dieser Liga selbtsverständlich.
Die Ananta-Moonphase ist bei Uhrsachen für CHF 4800 erhältlich – ein erstaunlicher Preis für so viel Uhr.
Youtube-Movie der Seiko Ananta Moonphase:
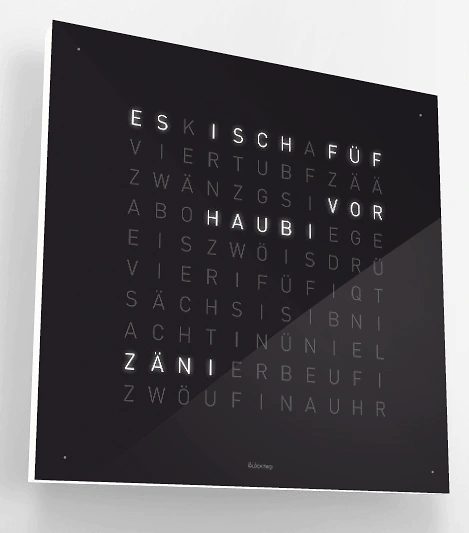
Qlocktwo: Jetzt in Berndeutsch!
16.06.2010In Zusammenarbeit mit dem Hersteller Biegert & Funk bringt Uhrsachen eine lokalisierte Version der Qlocktwo auf den Markt, in breitem Berner Dialekt.
Bei all den verfügbaren Sprachversionen konnten wir als in Bern ansässiges Unternehmen nicht abseits stehen: In Teamarbeit entwickelte Uhrsachen gemeinsam mit dem Hersteller Biegert & Funk eine besonders regionale Version in Berndeutsch. Dazu musste erst eine phonetisch korrekte Schreibweise des Berner Dialekts gefunden und dann in die passende Zeittabelle übersetzt werden. Entstanden ist eine völlig neue Buchstabenmatrix. „Es isch viertu ab zwöufi“, „Es isch haubi sächsi“ oder „Es isch zää ab nüni“ steht auf der Berner Qlocktwo geschrieben. Die Fronten der Berner Version gibt es in allen verfügbaren Farben der Qlocktwo.
Die berndeutsche Qlocktwo wird exklusiv bei Uhrsachen für CHF 1450.- angeboten, also trotz der kleinen Auflage zum gleichen Preis wie die anderen Sprachversionen.
Die berndeutsche Qlocktwo (und auch alle anderen Versionen) können Sie übrigens auch online bestellen. Sie sind sehr gut verpackt und der Versand ist problemlos.

Qlockone – die menschliche Uhr
16.06.2010Es hat, zugegeben, etwas von einer Bieridee: 24 Menschen bewegen 24 Festbänke 24 Stunden lang. Ein Ausdauerhappening für eine der wohl ungewöhnlichsten Arten der Zeitanzeige. Von den Machern der Qlocktwo.
Eine schräge Idee zu haben ist das eine. Sie aber dann auch umzusetzen, wenn der Aufwand beträchtlich ist, ist das andere. Marco Biegert und Andreas Funk, die beiden Erfinder der Qlocktwo, haben sich in den letzten Jahren intensiv mit Zeitanzeigen befasst. Ob die „Qlockone“ nun in die Kategorie Verrücktheiten oder Kunsthappening gehört, ist letztlich Interpretationsfrage (wir tendieren eindeutig auf das zweite). Als „just for fun, ein echter Non-Profit-Event“ bezeichnete es Andreas Funk gegenüber „Tick different“ selber.
Human Clock – Qlockone heisst das Projekt aus der Küche der beiden Kreativen. Sie nennen es „die erste Uhr, die aus einem Non-Stop-Film entstanden ist. Tatsächlich lief an einem lauen Sommertag 24 Stunden lang eine Videokamera auf einem Aussichtsturm in der Nähe von Schwäbisch Gmünd, dem Wohnort der beiden Tüftler. Und unten tragen 24 Menschen abwechselnd jede Minute Festbänke in der Gegend herum, laufend per Megaphon instruiert. Denn die Segmente für die Zeitanzeige, wie man sie von digitalen Uhren kennt, bestehen genau aus diesem weit verbreiteten Stück Festzeltmobiliar.
Es herrscht ein dauerndes Gewusel. Mal wird nur ein Segment verschoben, doch bei grösseren Veränderungen (wie beispielsweise zur vollen Stunde) kann es richtig zur Sache gehen, sind viele Trägerinnen und Träger im Einsatz. Nachts sind die Bänke mit Kerzen oder Licht beleuchtet. Und ganz früh morgens werden die Bänke nicht mehr ganz so dynamisch verschoben wie noch am Nachmittag. „Es war ein Event unter Freunden. Wir hatten einen Riesenspass. Und am nächsten Tag sind alle (mit Sonnenbrand) todmüde ins Bett gefallen. Aber über den Tag wird heute noch viel gesprochen“ erzählt Andreas Funk sichtlich amüsiert.
Die Qlockone ist vorerst als App fürs iPhone zu kaufen. Eines mit viel Speicherkapazität sollte es dann aber schon sein: Der 24stündige Film ist happige 834 MB gross und dürfte damit wohl eine der grössten iPhone-Apps überhaupt sein. In Arbeit ist zudem ein Bildschirmschoner für den PC und den Mac, der „im Sommer“ auf der Webseite von Biegert & Funk zu kaufen sein sollte.

Schnell reagiert: Die Eyjafjallajökull-Uhr
22.04.2010Bei der kleinen Genfer Uhrenmanufaktur Romain Jérôme hat man rasch auf den Vulkanausbruch in Island reagiert: Eyjafjallajökull DNA heisst das freche Einzelstück, in dem Stücke aus dem Asche speienden Vulkan integriert sind.
Bei Romain Jérôme hat man seit geraumer Zeit das Konzept, mit „DNA“-Material von legendären, historischen Erignissen zu arbeiten. Legendär sind die Tourbillons mit „Titanic-DNA“ oder „Moon-DNA“. Damit traf man nicht jedermanns Geschmack, aber der Erfolg war da.
Es war eine Frage der Zeit, bis eine Uhrenfirma den wütenden isländischen Vulkan zum Thema machen würde. Dass die kleine Genfer Firma, seit kurzem unter der Leitung des umtriebigen Kreativtäters Manuel Emch (der schon die erfolgreiche Renissance von Jaquet Droz herbeigeführt hatte), so rasch reagieren würde – damit hätte niemand gerechnet.
Die Uhr mit Automatikwerk trägt Asche und Lava des Eyjafjallajökull auf Zifferblatt und Lunette, deren authentische Herkunftmit einem Zertifikat attestiert wird. Man kann vom Umgang mit diesen Legenden halten, was man will – wir finden, die Uhr sieht teuflisch gut aus. Der Preis liegt bei rund 50’000.- CHF, lässt uns Manuel Emch direkt aus Island wissen. Hier sammelt der Chef die Steine noch selber.
Auch die Uhrenbranche wurde übrigens getroffen vom Flugchaos – allein bei der Swatchgroup sollen rund 500 Personen nicht rechtzeitig an ihren Arbeitsplätzen erschienen sein. Nicht auszumalen, was es für die Branche bedeutet hätte, wenn das Flugverbot während der Branchenmesse Baselworld gegolten hätte.

Moonstruck – Prof. Oechslins Monduhr
05.10.2009Uhren, die die Mondphasen anzeigen, gibt es viele. Ihn aber so anzuzeigen, dass man ihn „richtig“ sieht, hat erst die Moonstruck von Ulysse Nardin geschafft. Dahinter steckt – einmal mehr bei der Firma aus Le Locle – der geniale Uhrenerfinder Ludwig Oechslin. Tick different war bei der Präsentation der Moonstruck im Observatorium von Nizza dabei.
Der Anblick eines riesigen Vollmondes, der den Nachthimmel überquert und die Welt in sein fahles Licht taucht, lässt niemanden unberührt, und wer ganz seiner Schönheit und Majestät verfällt, wird zu Recht als „mondsüchtig“ bezeichnet (auf Englisch: Moonstruck). Neben dieser emotionalen Wirkung des Mondes werden Seefahrer und die Anwohner der Meere mit deutlich sichtbaren Auswirkungen seiner Kräfte konfrontiert: den Gezeiten. Dieses Phänomen des Ansteigens und Fallens des Wasserspiegels ist von lebenswichtiger Bedeutung, mit Nutzen aber auch vielen Gefahren verbunden.
Die Idee zur Moonstruck geht weit zurück. Vor mehr als 20 Jahren entdeckte Rolf Schnyder, Inhaber von Ulysse Nardin, am Arm eines Firschers in Amerika eine Uhr, die die Gezeiten anzeigte. Krieger hiess die Marke aus Florida, es war kein grosser Designwurf und von eher billiger Machart. Aber die Funktion faszinierte Schnyder.
Zu der Zeit gab es jedoch bei Ulysse Nardin reichlich andere Baustellen, das Projekt einer Gezeitenuhr verschob Schnyder auf später. Viel später.
Die Magie des Mondes
Erst anfang dieses Jahrtausends, in einer lauen Vollmondnacht, erschien die Idee wieder in Schnyders Bewusstsein. Der Mond nämlich spielt die entscheidende Rolle beim Phänomen der Gezeiten. Schnyders Firma hatte mittlerweile bedeutende Uhren erschaffen. Insbesondere die „Trilogie der Zeit“, eine Serie von drei Uhren mit astronomischen Funktionen, verschaffte Ulysse Nardin viel Reputation bei Kennern und vor allem sehr viel Kompetenz in diesem Themenbereich. Alle drei Modelle aus der Trilogie waren nach grossen Astronomen benannt: Astrolabium Galileo Galilei, Planetarium Copernicus und Tellurium Johannes Kepler. Der grosse Denker hinter dieser Serie war Ludwig Oechslin, er schaffte es mit seinen Überlegungen, die hoch komplizierten astronomischen Zusammenhänge auf eine brauchbare und zuverlässige Anzeige in Armbanduhren umzusetzen.
Strahlen um die Wette: Anlässlich der Präsentation der Moonstruck an historisch bedeutender Stätte im Observatorium von Nizza war der Stolz des Ulysse Nardin-Teams nicht zu übersehen. Die Hauptbeteiligten am Projekt: hinten Ulysse Nardin-CEO Rolf Schnyder, der technische Direktor Lucas Humair sowie der langjährige Direktor Pierre Gygax, vorne MIH-Direktor Prof. Dr. Ludwig Oechslin und Marketing- und Verkaufschef Patrick Hofmann, hinten.
Professor Oechslin gilt als grosse Kapazität für astronomische Uhren. Im Jahr 2001 wurde seine wissenschaftliche Brillanz und seine Bedeutung als einer der weltweit innovativsten Uhrmacher gewürdigt, indem ihn die Stadt La Chaux-de-Fonds mit der Leitung des Musée International de l`Horlogerie MIH betraute, der umfassendsten und bedeutendsten horologischen Sammlung der Welt.
Oechslin steckt aber auch hinter vielen weiteren einzigartigen Innovationen von Ulysse Nardin. So erfand er die ungemein praktische Schnellkorrektur der Lokalzeit mit zwei Drückern für Uhren mit zweiter Zeitzone, konstruierte ein geniales Grossdatum, das vor- und rückwärts bewegt werden kann. Er schuf damit die Grundlage für die GMT Perpetual, der in der Szene als die schlaueste Konstruktion eines Ewigen Kalenders gilt. Nochmals schrieben Ulysse Nardin und Oechslin schliesslich Uhrengeschichte, als 2001 der „Freak“ präsentiert wurde. Diese Uhr hat weder Zeiger noch Zifferblatt noch Krone. Bei diesem Karussell-Tourbillon mit sieben Tagen Gangreserve fungieren die beiden Werksbrücken als Zeiger und zeigen so die Zeit an. Mehrere technische Neuheiten waren in der Uhr vereint, unter anderem die „Dual Direct“-Hemmung, ein vollkommen neues Regulierorgan, das ohne den bisher unvermeidlichen Anker auskommt und das erste Uhrwerk war, das Siliziumräder verwendete, um Reibung und Massenträgheit zu vermindern. Die Medienpräsenz war enorm, und bis heute ist der Freak in seiner Art unerreicht. „Der Freak hat die Uhrenlandschaft verändert“ sagt Rolf Schnyder ohne Bescheidenheit. Und er hat gewiss nicht Unrecht damit. „Erst nach dem Freak begannen andere Hersteller, Uhren zu gestalten, die bisher unumstössliche Regeln über den Haufen warfen. Der Freak war die erste Uhr, die architektonische Elemente mit einem vollkommen offen gelegten Innenleben verband. Und der Freak inspirierte unzählige Konzepte, die man in den letzten Jahren sehen konnte“.
Die Entwicklung aller dieser Uhren wurde zum grössten Teil von derselben Crew bei Ulysse Nardin umgesetzt. „Oechslins Ideen in reale Uhren zu verwandeln ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Von der Grundlagenarbeit bis zu fertigen Teilen ist es ein weiter Weg. Es gibt Bestandteile, deren Form technisch absolut einleuchtend ist, aber für die man zuerst einen Weg finden muss, dass man sie überhaupt produzieren kann“ erläutert uns Pierre Gygax, Ulysse-Nardin-Direktor. „Und nochmals ein grosser Schritt ist dann die Produktion in Serie.“ Konflikte zwischen dem Erfinder und den Ausführenden wären eigentlich vorprogrammiert. Doch Lucas Humair, Technischer Direktor in Le Locle, winkt ab. „Wir haben mit Ludwig Oechslin einen sehr guten Draht, die Kommunikation klappt bestens. Und er ist immer für uns da, wenn wir seinen Rat benötigen.“
Ulysse Nardin verfügt also heute über einen umfassenden Baukasten von Elementen. Und einen Patron mit vielen Ideen. Kurz nach der Lancierung des „Freak“ ging Schnyder auf Oechslin zu und konfrontierte ihn mit seiner Vision einer Gezeiten- und Mondphasenuhr. „Ja, das sollte gehen“ war Oechslins knappe Antwort – die Antwort, die Schnyder letztlich erwartet hatte. Dr. Oechslin verzog sich also in seine Denkkammer und grübelte. Rechnete, wie immer am Anfang im Kopf, und hatte schliesslich die entscheidende Idee, wie man das umsetzen könnte. Und natürlich spielte mit, dass mit der Trilogie der Zeit und den anderen Konstruktionen schon viel Grundlagenarbeit geleistet worden war. Grundlagenarbeit, die vor allem auch zum Resultat hatte, dass sehr komplexe Funktionen „unter der Haube“ waren, aber dass die Bedienung der Uhren stets sehr intuitiv und weitgehend narrensicher war.
Die Umsetzung
Für eine schlaue, verständliche Anzeige von Mond und Gezeiten musste zuerst ein Modell definiert werden. Eigentlich dreht sich die Erde ja um ihre Achse. Um Stand von Mond und Sonne anzuzeigen, ist es aber einfacher, die Erde als fixen Punkt zu definieren und Sonne und Monde darum kreisen zu lassen.
Basis der Konstruktion bilden zwei Scheiben, eine für die Sonne und eine für den Mond. „Hier waren uns die Erfahrungswerte für die Arbeit mit langsam drehenden Scheiben aus dem Bau des Astrolabiums und des Planetariums sehr dienlich“ sagt Pierre Gygax. „Scheiben oder Räder, die schnell drehen, sind einfach. Komplex sind solche Systeme, wenn sie, wie die Mondscheibe bei der Moonstruck, nur einmal im Monat um die eigene Achse drehen.“
Wissenschaftlich korrekter Mond
Der neue, patentierte Mechanismus für die Anzeige der Mondphase besteht aus zwei übereinander gelagerten Scheiben, welche um die fixierte Erdscheibe im Zentrum rotieren. In der oberen Scheibe befindet sich ein runder Ausschnitt, der die Position des Mondes in Relation zu Erde und Sonne darstellt, während die untere Scheibe von einer Kurvenlinie in fünf goldfarbene und fünf dunkelblaue Zonen unterteilt wird, die zusammen mit der oberen Scheibe die korrekten Mondphasen anzeigen. Die beiden Scheiben drehen sich unterschiedlich schnell, und während sich der kreisrunde Ausschnitt über die untere Scheibe bewegt, erscheint darin langsam die goldene Zone und stellt den zunehmenden Mond dar, bis das Fenster vollständig goldfarben gefüllt ist und den Vollmond anzeigt. Danach wandert von rechts wieder allmählich die dunkelblaue Farbe in den Ausschnitt, der Mond nimmt ab.
Der Grund, weshalb auch die untere Scheibe rotiert, liegt in den Schwierigkeiten, eine äusserst genau Mondphasenanzeige zu konstruieren. Das Hauptproblem besteht in der synodischen Rotationsperiode des Mondes von 29,5305881 Tagen. Ein mechanisches Uhrwerk, welches eine Mondphasenanzeige antreibt, liefert üblicherweise nur Drehungsintervalle von 12 bzw. 24 Stunden und von 60 Minuten (Stunden-und Minutenzeiger), und kann deshalb mittels Zahnrädern keine Intervalle von 29,5305881 Tagen darstellen. Für eine korrekte Darstellung benötigte man ein Zahnrad mit 295.306 Zähnen. Die Realisierung scheitert daran, dass dieses Rad einen gigantischen Durchmesser haben müsste, unvereinbar mit den Dimensionen einer Armbanduhr.
Aus diesem Grund sind Hersteller mechanischer Armbanduhren gezwungen, die Umsetzung der Mondphasenanzeige stark zu vereinfachen, was Korrektureingriffe um einen Tag etwa alle drei Jahre nötig macht (siehe auch die Mondphasenuhr von Stepan Sarpaneva auf Seite 18). Die Konstruktion der Moonstruck verteilt die Rotation aber auf zwei Scheiben und vereinigt deren Bewegungen in einer Anzeige. Mit diesem Kunstgriff erreichte Ludwig Oechslin einen äusserst hohen Grad an Anzeigegenauigkeit. Deshalb benötigt die Moonstruck theoretisch mehr als einhunderttausend Jahre, bevor ihr Mondausschnitt einen Vollmond anzeigt, obwohl tatsächlich Neumond herrscht.
Exakte globale Darstellung der Gezeiten
Der offenkundigste Einfluss des Mondes auf die Erde ist derjenige auf Ebbe und Flut, die Gezeiten (siehe auch Seite 16). Angezogen von der Gravitation des Mondes, hebt sich die Meeresoberfläche in dessen Richtung hin an und folgt ihm auf seiner Drehung um die Erde. Auch wenn Gezeitenanzeigen auf Uhren nichts Neues sind, ist die Moonstruck doch die erste Uhr, welche ihrem Träger erlaubt, die weltweiten Veränderungen der Gezeiten zu beobachten, wie sie von den Anziehungskräften von Mond und Sonne beeinflusst werden.
Für Ludwig Oechslin war es ein logischer Schritt, die astronomisch korrekte Mondphase durch ein Gezeitendisplay zu ergänzen, welches eine – grobe – Ablesung der Gezeitentendenz an einem gegebenen Punkt gestattet.
Durch die rotierenden Darstellungen von Sonne und Mond ist es darüber hinaus sogar möglich, die kumulativen und subtraktiven Wirkungen ihrer Anziehungskräfte zu erkennen, die in Springfluten und Nipptiden resultieren. Das Gezeitendisplay der Moonstruck abzulesen ist denkbar einfach: Sowohl die Sonnen- als auch die Mondscheibe weisen dunkelblaue Sektoren auf, welche die Anziehungskräfte dieser beiden Himmelskörper und auch die Zentrifugalkraft der Erdrotation darstellen. Die Sektoren um Sonnensymbol und Mondfenster stehen für ihre Gravitation, welche die Ozeane nach oben zieht. Die kleineren Sektoren auf der gegenüber liegenden Seite stellen die Gezeitenberge dar, welche als Auswirkung der Fliehkraft
der Erde entstehen.
Dual-Time-System für die schnelle Zeitverstellung
Neben den astronomischen Anzeigen ist die Moonstruck aber auch eine sehr praktische Uhr mit hohem Bedienungskomfort. Die Fähigkeit, den Stundenzeiger in Einstundensprüngen vor- und rückwärts schnell zu verstellen, indem man sich einfach der beiden Drücker an der linken Gehäuseseite bedient ist von den legendären Dual Time-Modellen von Ulysse Nardin bereits bestens bekannt. Reisende, die oft ihre Zeitzone wechseln, werden um das Feature froh sein. Stunden- und Minutenzeiger sind mit Superluminova beschichtet und darum auch nachts gut ablesbar.
Ein dritter Zeiger, erkennbar durch die markant Pfeilspitze, zeigt das aktuelle Datum an. Dieser Zeiger kann schnell und zu jeder Tageszeit, sowohl vor- als auch rückwärts eingestellt werden.
Nobles, elegantes Gehäuse
„Die Zeit des Bling“ und des grenzenlosen Wachstums von Gehäusen ist vorbei“ erklärte Rolf Schnyder bei der Moonstruck-Präsentation. „Wir wollten vielmehr eine elegante Uhr schaffen.“ Stolze 46 mm Durchmesser bringt die Moonstruck dennoch auf den Arm. Kleiner war die Komplikation nicht hinzukriegen.
Geniales Werk
Angetrieben wird die Moonstruck vom Manufakturkaliber UN-106, das von Ulysse Nardin komplett inhouse gefertigt wird. Es besitzt eine Ankerhemmung aus Silizium. Auch die Unruhespirale wird mit neuester Siliziumtechnologie gefertigt. Das Werk mit beidseitigem automatischem Aufzug verfügt über eine Gangreserve von ca. 50 Stunden.
Das Werk der Moonstruck ist ein richtiges Manufakturkaliber. Es wird von Ulysse Nardin entwickelt und wird in den Produktionsstätten in Le Locle und La Chaux-de-Fonds vollkommen inhouse gefertigt.
Limitierte Serie
Die Moonstruck wird in zwei Varianten angeboten, entweder in einem Gehäuse aus 18 Kt. Roségold oder in Platin, beide mit integriertem Alligatorband. Sowohl auf der Vorder- als auf der Rückseite sind die Saphirgläser antireflexbeschichtet. Die rotierenden Scheiben sind mit Perlmutt belegt, die Erde in der Mitte ist eine Handmalerei. Die Lunette mit den vertieften Zahlen der Datumsskala ist aus dunkelblauer High-Tech-Keramik und damit vollkommen kratzfest. Die Uhr wird in einer limitierten Serie von je 500 Exemplaren hergestellt.

Ein goldenes Meisterwerk: Sarpaneva Korona Red Gold
05.09.2011Während 10 Jahren hat sich der Finne Stepan Sarpaneva einen Namen gemacht mit seinen ungewöhnlichen Uhren, die er in kleinen und kleinsten Serien fertigte. Alle waren sie bisher aus verschiedenen Stahlvarianten. Jetzt lanciert er das erste Goldmodell – das Warten hat sich gelohnt, es ist atemberaubend schön.
„Stahl entspricht meiner Liebe zur Einfachheit. Seit meiner Jugend liebe ich Motorräder, auch darum ist dieses Material mein Favorit. Nie schien es mir, dass Stahl minderwertiger sein soll als Edelmetalle“ sagt der oft verschlossene Finne dazu. „Meine erste Uhr, die „Time Tramp“ war eine Uhr mit einem Gehäuse aus einem grossen Getriebezahnrad einer Harley – also aus Hardcore-Stahl.“
Immer wieder wurde ich in den vergangenen Jahren von Kunden gefragt, warum ich keine Golduhren machen würde. Für mich war einfach die Zeit dafür noch nicht reif. Emotional bin ich auch dem Gold stark verbunden. Mein Vater war ein grosartiger Schmuckdesigner. Auch mich reizt das Gestalten von Schmuck sehr – darum ist der Einstieg mit Golduhren vielleicht auch der Einstieg in Schmuck, ein Sammeln von Erfahrung im Bearbeiten dieser edlen Materialien.“
Für Stepan kam es nicht in Frage, einfach eine goldene Version des bestehenden Stahlgehäuses zu machen. Darum übernimmt das Rotgoldgehäuse noch die Formensprache der Vorgänger, hat aber dennoch einen ganz eigenen Charakter bekommen.
Mit ihren 42 mm Durchmesser (gegenüber 44 der K3 in Stahl) macht sie sich auf schmalen oder breiten Handgelenken perfekt. Auch die Ergonomie wurde verbessert, die Uhr trägt sich sehr angenehm. Die überarbeitete, perfektionierte Form der Anstösse erlaubt jetzt die Verwendung eines Bands mit runden Anstössen. „Ich wollte einen fliessenden Übergang zwischen Band und Gehäuse, aus Gründen der Optik, aber auch für einen erhöhten Tragekomfort.“
Die eigenwillige Umsetzung der Mondphasenanzeige war schon bei der Stahlversion der Korona K3 ein charakteristisches Merkmal für Sarpanevas Stil. „Wissen Sie, hier in Finnland sind wir nicht wirklich extrovertierte Menschen. Vielleicht hat das mit unserer Geschichte zu tun, sicher aber mit der Kälte und den extrem langen Winternächten und den entsprechend langen Sommertagen. Man muss lernen, das Gleichgewicht zu behalten. Darum schweben hier alle mit einer Aura von leichter Melancholie durchs Leben, anders kann ich das nicht beschreiben. Darum war für mich ein lächelnder Mond definitiv kein Thema, diese Monde sehen aus wie die unsäglich Smileys in den E-Mails. Mein Mond hat diese Aura leicht aristokratischer Melancholie, mit einer angedeuteten Unentschlossenheit, ob er jetzt generell eher traurig oder glücklich sein soll. Es ist ganz klar ein finnischer Mond.“
Das Umsetzen des Mondes ist extrem komplex, Stepan scheut keinen Aufwand. Die Scheibe ist nur 0,4 mm dick und hat trotzdem vier unterschiedliche Höhen. In einem ersten Schritt entstand eine Zeichung in sechsfacher Vergrösserung. Anschliessend wurde ein Rohmodell in dieser Grösse mit den vier verschiedenen Niveaus ausgesägt und diese Teile aufeinander fixiert. Mit dem Pantographen wird dann auf einer feinen Kupferscheibe in Originalgrösse die Form übertragen und ausgefräst. Diese Kupferscheibe wird dann von einem Meistergraveur perfektioniert. Sie dient dann als Elektrode, um in einem elektrischen Verfahren eine Form aus Stahl herzustellen, in die noch die Augen des Monds von Hand in die Form hinein modelliert werden. Dann wird die Form diamantpoliert, gehärtet und noch einmal poliert. Mit der Form werden dann die Rohlinge für die fertige Mondscheibe hergestellt, die dann nocheinmal überarbeitet werden.
Auch auf dem speziellen Rotor auf der Rückseite findet sich noch ein Mond. Dies aus ästhetischen, aber auch aus technischen Gründen. „Der Mond gibt dem Rotor auf der einen Seite noch ein wenig zusätzliches Gewicht, was für eine gute Aufzugsleitung wichtig ist. Hier fliesst meine Erfahrung aus dem „customizen“ von Motorrädern ein: Ich sehe nicht ein, wieso nicht auch rein funktionale Teile nicht attraktiv und schön zum Betrachten sein sollen.“ Insgesamt hat die Korona als drei Monde – zwei auf der Vorder- und einen auf der Rückseite.
Das skelettierte Zifferblatt und der Rotor in den Koronas sehen auf den ersten Blick einfach aus. Die Arbeit dahinter ist aber enorm. 260 Ausschnitte sind es beim nur 0.3 mm dünnen Zifferblatt. Sie werden mit Lasertechnik ausgeschnitten, aber jede einzelne Schnittkante muss noch von Hand bearbeitet werden, damit sich das Licht überall gleichmässig bricht. Die Produktion eines kompletten Zifferblatts und des dazugehörigen Rotors und das Installieren der Teile mit der Mondphase dauert eine gute Woche.
Das Werk stammt vom Schweizer Hersteller Soprod, Lieferant für viele Marken der Haute Horlogerie. Es wird in Sarpanevas Atelier komplett auseinandergenommen und dann stark modifiziert. Das beginnt beim Überarbeiten der Platine. Die gesamte Mondphasenkomplikation wird in Stepans Atelier entwickelt, produziert und montiert. Im Gegensatz zu vielen Mondphasenkalibern wird die von Sarpaneva über die Krone verstellt, und nicht über einen Drücker. Dies ist im Alltag angenehmer, und macht auch eine zusätzliche Öffnung für einen Drücker im Gehäuse überflüssig.
Wenn man sich bewusst wird, welchen Aufwand die kleine Crew rund um Stepan Sarpaneva in seinem Atelier in Helsinki leistet, wird rasch klar, warum keine hundert Uhren pro Jahr gefertigt werden. „Wir sind eine kleine Firma und wollen das auch bleiben. Massenproduktion interessiert uns nicht. Unsere Uhren sind für Menschen gedacht, die echtes Handwerk und Individualität noch richtig zu schätzen wissen“ sagt der findige Finne. Mit einem melancholischen, echt finnischen Ansatz fast eines Lächelns im Gesicht.
Durchgestylt bis ins letzte Detail: Auch die perfekt verarbeitete und konzipierte Uhrenbox aus massivem Holz mit gefrästen Aluminiumteilen kommt nicht „ab der Stange“, sondern ist eine Eigenkreation von Stepan Sarpaneva. Inklusive Mondsymbol auf der Vorderseite.
Die Korona Red Gold ist bei Uhrsachen zur Zeit verfügbar. Werfen Sie bei Gelegenheit bei uns einen Blick auf dieses Meisterstück. Aber Achtung: Ihr Sparschwein ist danach in grosser Gefahr, geschlachtet zu werden.

Planet Earth: Ein Meisterwerk von Ludwig Oechslin und Ulysse Nardin
09.04.2009Ludwig Oechslin hat mit seinem „Astrolabium“ Ulysse Nardin 1985 zurück auf die Weltbühne der Uhrenhersteller gebracht. Eine Konsequenz aus diesen Entwicklungen ist nun die an der Baselworld 2009 präsentierte „Planet Earth“. Ein Zeitobjekt, das uns wirklich zum Staunen brachte.
Planet Earth – die Zeitmaschine von Ulysse Nardin
Als Rolf Schnyder 1983 die Firma Ulysse Nardin übernahm, stand es schlecht um den Betrieb. Um die Traditionsmarke auf dem Markt neu zu lancieren, war ein Geniestreich gefragt. Dieser folgte, als Schnyder bei einer Visite im Atelier des Luzerners Jörg Spöring ein Astrolabium entdeckte, eine grosse, komplizierte astronomische Uhr. Deren Erbauer war Spörings Lehrling, ein gewisser Ludwig Oechslin. Erst mit 24 Jahren hatte dieser – nach einem abgeschlossenen Studium in Archäologie, Geschichte, Latein und Griechisch – seine Uhrmacherlehre begonnen, fasziniert von der Komplexität der Mechanismen. Schon bald nach Lehrbeginn wurde er in den Vatikan gesandt, um die mehr als 250 Jahre alte „Farnese Uhr“ zu reparieren und zu restaurieren. Bei dieser Arbeit lernte er enorm viel über Funktionsweise und Konstruktion und ihren wissenschaftlichen Hintergrunde. Im Anschluss hängte er noch Studien in Astronomie, Philosophie und Wissenschaftsgeschichte an, die er 1983 an der Universität mit einem Doktortitel abschloss. Oechslin wurde zum anerkannten Experten für astronomische Zeitmesser vom 16. bis 18. Jahrhundert.
„Wer soll ein Interesse daran haben, das kaufen?“ war Oechslins Antwort auf Schnyders Frage, ob er ein Astrolabium als Uhr fürs Handgelenk entwickeln könne. Der Funke zwischen dem Unternehmer Schnyder und dem Wissenschaftler und Entwickler Oechslin sprang sofort, und Oechslin entwickelte in der Folge für Ulysse Nardin eine Uhr, die für mehrere Einträge im Guiness Buch der Rekorde sorgen sollte. 1985 wurde das Astrolabium Galileo Galilei an der Basler Uhrenmesse vorgestellt und war das Gesprächsthema. Die extrem komplexe Uhr zeigt neben der Lokalzeit die Sonnenzeit, den Lauf und die Finsternisse von Sonne und Mond sowie die Position bestimmter Fixsterne. Es dient zudem auch noch der Bestimmung der Himmelsrichtungen und der Jahreszeiten, der Bewegung des Tierkreises.
Die Trilogie der Zeit
Doch das Astrolabium bildete nur den Anfang – es sollte eine ganze Trilogie astronomischer Armbanduhren folgen. Dr. Oechslins Tetendrang war kaum zu bremsen, und Schnyder stellte die notwendigen Kapazitäten und Mittel zur Verfügung. Der zweite Streich war 1988 das Planetarium Copernicus. Es kombiniert das ptolemäische Weltbild mit der Erde im Zentrum woei das heliozentrische Weltbild von Copernicus mit der Sonne im Mittelpunkt des Universums. Abgelesen werden können die exakten Positionen der Planeten in Relation zur Sonne und zur Erde. Der Mond rotiert um die Erde, und auf einem ewigen Kalender werden die Monate sowie die Zeichen des Tierkreises angezeigt.
Vollendet wurde die Trilogie 1992 mit dem Tellurium Johannes Kepler. Dieses Meisterstück der Uhrmacherei stallt die Rotation der Erde in ihrer exakten geographischen Form dar, wie sie vom Nordpol aus zu sehen ist. Immer ablesbar sind die Kontinente, die Ozeane und die Weltzeit auf einem Zifferblatt, das in der alten „Emaille-Cloisonné“-Technik gefertigt wird. Eine flexible Feder beschreibt einen Bogen und zeigt damit den von der Sonne beschienenen Teil der Erde, neben dem Ort und der Zeit des Sinnenauf- und Untergangs. Der Mond kreist im Gegenuhrzeigersinn um die Erde, mit seiner beleuchteten Seite jederzeit der Sonne zugewandt. Ein Drachenzeiger gibt Sonnen- und Mondfinsternis an.
Die Trilogie der Zeit heimste viele Preise ein und erhielt feste Plätze in den Vitrinen und Tresoren der weltweiten Uhrensammlergemeinde.
Planet Earth – die geniale Tischuhr
An der Baselworld 2009 präsentierte Ulysse Nardin die Tischuhr „Planet Earth“. Sie ist eine faszinierende dreidimensionale Darstellung der Erde im Universum, die die genaue Position der Erde im Verhältnis zu Sonne, Monde und den Fixsternen zeigt. Für diejenigen, die ein gewisses Mass an astronomischem Grundverständnis und -wissen haben – wie dies schon bei den Modellen der Trilogie der Zeit der Fall ist.
Die Erde wird repräsentiert durch die transparente Kugel aus Kristallglas mit den aufgemalten Konturen der Kontinente. Die Kugel ist fix – im Innern hingegen präsentiert sich eine weitere Kristallkugel, die das Modell des Universums aus Sicht der Erde darstellt. Sie dreht sich in der Geschwindigkeit eines Sternentags, also 23 Stunden, 56 Minuten und 4 Sekunden. Sichtbar sind die Tierkreiszeichen, eine Monatsskala und die wichtigsten Fixsterne.
Ein grosser Sonnenzeiger (im Bild obern auf der rechten Seite) dreht sich aus dem Zentrum heraus. Er zeigt jeweils diejenigen Teile der Erde, die gerade von der Sonne beschienen werden. Der Mondzeiger (im Bild auf der linken Seite, im unteren Bild im Detail) macht in 24 Stunden, 52 Minuten und 42 Sekunden eine Umdrehung und zeigt, von welchem Teil der Erde aus der Mond gerade sichtbar ist.
Ein weiteres wichtiges Element ist der Drachenzeiger (der auch schon im Astrolabium eine wichtige Rolle spielt). Dieser blaue Zeiger dreht sich in 18’613 (ja, achtzehntausendsechshundertdreizehn) Jahren einmal schneller als die innere Glaskugel (diejenige mit den Fixsternen und den Tierkreiszeichen). Seine Aufgabe ist es, in Verbindung mit dem Sonnen- und dem Mondzeiger alle Sonnen- und Mondfinsternisse anzuzeigen. Für Normalsterbliche sind diese Zusammenhänge bereits schwierig zu begreifen – wie meisterlich ist erst die Leistung, dies in ein solches Modell umzusetzen.
Die Planet Earth kann aber auch noch die ganz normale Tageszeit anzeigen, dies mit einer Uhr, die in den an ein Gehäuse eines Marine Chronometers erinnernden Sockel integriert ist. Das Zeitobjekt wird von Hand aufgezogen und verfügt über eine komfortable Gangreserve von 30 Tagen. Sollte der glückliche Besitzer (oder sein Personal) das Aufziehen einmal vergessen, so kann die Planet Earth über einen Drücker unterhalb der inneren Kugel einfach wieder auf die aktuelle Zeit eingestellt werden, inklusive aller synchronisierten astronomischen Anzeigen.
Die einmalige Zeitmaschine ermöglicht es, das Universum auf seinen Schreibtisch zu stellen. Dies muss man sich einerseits leisten können (Preise geben wir auf Anfrage gerne bekannt) und man muss auch rasch genug reagieren, denn es werden nur 99 Exemplare hergestellt.

Ulysse Nardin Diver Perpetual: Die Uhr für den ganz langen Tauchgang
08.04.2009Taucheruhren haben in erster Linie die Funktion, zuverlässig und mit sehr hoher Ablesbarkeit die Zeit unter Wasser anzuzeigen. Sie sind aber auch Symbol für einen sportlichen Lebensstil und die Freude am Wasser. Wer zudem noch eine hoch stehende Komplikation möchte, wird jetzt wieder bei Ulysse Nardin fündig.
Die jetzt vorgestellte Perpetual Diver bietet aber weit mehr. Legendär ist Ludwig Oechslins Konstruktion des Ewigen Kalenders für die GMT Perpetual-Modelle. Es ist der wohl am robustesten und cleversten konstruierte Mechanismus für diese Komplikation, und – zumindest nach unserem Wissensstand – der einzige, der über die Krone vorwärts und rückwärts eingestellt werden kann. Auch der Schrecken des Jahres 2100 findet mit dieser Uhr nicht statt. Während andere Ewige Kalender zum Hersteller geschickt werden müssen, kann derjenige von Ulysse Nardin mit einer simplen Korrektur über die Krone selber justiert werden (von den glücklichen Nachfahren, die diese Uhr dereinst geerbt haben werden). Schlau ist auch die Anordnung der Anzeigen: Im Uhrzeigersinn liest man Wochentag, Datum (in Form des von Ulysse Nardin patentierten Grossdatums), Monat und Jahr ab.
Nach der limitierten Marine Perpetual und früheren Acqua Perpetual-Modellen gibt es nun den Ewigen Kalender endlich wieder im Tauchergehäuse. Damit man in einem Schaltjahr auch am 29. Februar den Datumswechsel unter Wasser richtig mitbekommt. Das markante Gehäuse mit 42.7 mm Durchmesser entstammt der Marine-Kollektion, modern und frisch ist die Farbgebung mit schwarzen und orangen Elementen (eigentlich eine richtige Uhrsachen-Uhr, ganz in unseren Firmenfarben gehalten). Die – wie es sich für eine richtige Taucheruhr gehört – nur im Gegenuhrzeigersinn drehbare Lunette ist hochwertig verarbeitet und besticht durch ihr präzises Einrasten. Ein Boden mit Saphirglasfenster gibt den Blick auf das schön finissierte, chronometerzertifizierte Manufakturwerk UN-33 frei. Gut zu sehen ist auch der Rotor aus 22 Kt. Weissgold mit dem markentypischen Ankersymbol.
Für hohen Tragkomfort sorgt das bewährte Kautschukband mit Faltschliesse und zwei Titanelementen – auch ein Stahlband ist lieferbar. Wer diese sportliche Alltagsuhr mit einer der nach wie vor interessantesten Komplikationen der Uhrmacherei besitzen möchte, muss sich rasch entscheiden, denn sie wir nur in 500 Exemplaren gebaut.
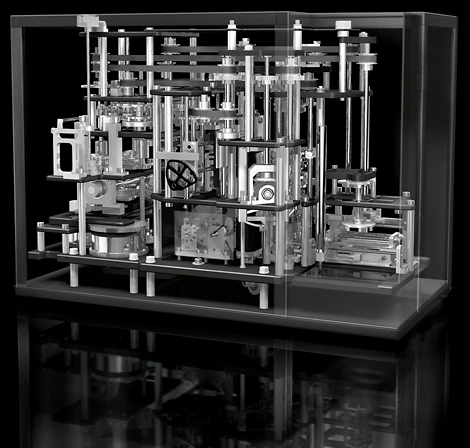
Mechanische Poesie: die machine à écrire le temps von Jaquet Droz.
02.04.2009„Und was bringt`s“ fragt mein dreizehnjähriger Sohn, als ich ihm die Bilder der wohl erstaunlichsten Maschine zeige, die ich je gesehen habe. „Muss es denn etwas bringen?“ frage ich zurück. Der Versuch, die Poesie der Mechanik zu erklären, scheitert leider.
Auch nach acht Jahren Entwicklungsarbeit ist sie noch im Prototypenstadium. Doch immerhin existiert jetzt ein funktionierendes Exemplar. Wir hatten das Privileg, uns die „Zeitschreibemaschine“ von Manuel Emch demonstrieren zu lassen, dem umtriebigen Patron der Uhrenmanufaktur Jaquet Droz. Grosser Stolz mischt sich bei ihm mit dem Enthusiasmus, den Jungs aufbringen, wenn sie etwas besonderes vorzeigen können, an dem sie lange getüftelt haben, und das dann endlich funktioniert.
Ein Rückblende: Jaquet Droz wurde ausgangs des 18. Jahrhunderts berühmt durch seine „Androiden“. Nahe der Hexerei wurden sie eingeordnet, seine unglaublich komplexen Konstruktionen. Königshäuser in ganz Europa liessen sich von Jaquet Droz` magischen Androiden verzaubern, den Schriftsteller, die Musikerin und den Zeichner. Die Androiden sind heute übrigens im Musée d`art et d`histoire Neuchâtel zuhause und werden dort jeden ersten Sonntag im Monat in Bewegung versetzt – ein Spektakel, das man einmal gesehen haben muss.
Eine Firma kann sich auf verschiedene Arten an ihre Geschichte anlehnen. Das gibt es plumpe, eher einfallslose Remakes (Beispiele sind die Heuer Monaco oder die Vintage-Kollektion von IWC) oder gescheiterte Retro-Designs (VW New Beetle oder Chrysler PT Cruiser). Erfreulicher sind gelungene Transportierungen in die heutige Zeit (Mini, Fiat Cinquecento, Ulysse Nardin mit seiner Serie der Marine Chronometer für Handgelenk).
Jaquet Droz hat mit seiner erfolgreichen Linie der „Grande Seconde“ bereits eine stilistisch einwandfreie Portierung der Vergangenheit im Portefeuille. Mit der „Machine à écrire le temps“ geht sie nun ganz eigene Wege. „Wir wollten nicht einfach einen neuen Androiden bauen – obwohl das eigentlich das naheliegendste gewesen wäre“ erläutert Manuel Emch. „Es ging uns darum etwas völlig neues zu schaffen. Etwas unmögliches möglich zu machen, aber auch eine philosophische Betrachtung der Zeit zu kreieren. Die Zeit ist der absolute Luxus, das meist gefragte Gut. Und auch das seltenste, selbst wenn man sie am liebsten teilt. Ungreifbar, flüchtig, einem Rhythmus gehorchend, auf den niemand Einfluss hat – die Zeit fasziniert, hypnotisiert und seit jeher versucht der Mensch vergeblich ihren Lauf aufzuhalten. Sie wurde mit Sonnenstrahlen, mit Sand- und Wasseruhren, mit voluminösen Standuhren und dann mit Taschenuhren gemessen. Immer und überall gehorchte man der gleichen Besessenheit: Die vergehende Zeit einzufangen. Wenn man sie schon nicht anhalten konnte, so wollte man doch wenigstens ihre Existenz beweisen. “
Entstanden ist in den vergangenen acht Jahren eine wahre Maschine der Superlative. Eine „retro-futuristische Hommage“ nennt es Emch. Der Aufwand, um die aktuelle Uhrzeit aufzuschreiben, ist gewaltig.
–> Klicken Sie hier für einen kleinen Film über die Maschine.
Einige Zahlen zeigen, wie viel Aufwand betrieben wurde: Über 1200 Einzelteile, darunter 84 Kugellager, 50 Kurvenscheiben und 9 Zahnriemen. Tinguely hätte seine Freude daran. Geschützt wird die unglaubliche Konstruktion von einem Gehäuse aus Flüssigkristall-Glas, das selektiv den Blick auf die Mechanik freigibt. Ausgelöst wird der Zeitschreiber durch eine einfache Berührung. Man legt ein Blatt Papier auf die dafür vorgesehene Stelle, und nach einigem Drehen und feinem Rattern schreibt ein Stift vierstellig die aktuelle Uhrzeit auf. Eigentlich der wahre „Chrono-Graph“, der „Zeit-Schreiber“.
Als „gigantischer Meccano, zusammengebaut von einem dislexischen Uhrmacher“ bezeichnete der französische Uhrenjournalist das Ganze ironisch, aber voller Bewunderung. „Ein echtes Beispiel für die Horlogerie 2.0“, ergänzt Pons in Anlehnung an den Begriff des Web 2.0. Wie alle anderen, die die Maschine bewundern durften konnte auch er sich der Faszination nicht entziehen.
28 Exemplare dieses aussergewöhnlichen Objekts werden gebaut, verteilt auf mehrere Jahre. „Wir haben die Kapazitäten für wenige Exemplare pro Jahr“ erklärt Emch die Limitierung. Rund 400’000 Franken wird die Maschine kosten. „Darin eingerechnet ist aber auch eine „On-site-Garantie“ von acht Jahren. „Die Maschine im Falle eines Defekts zu versenden ist zu heikel. Darum wird einer unserer Spezialisten an jeden Ort der Welt reisen, um die Maschine wieder instand zu setzen, sollte sie einmal Probleme bereiten.“
Fazit: 400’000 Franken sind bestimmt sehr viel Geld. Wäre mein Sparschwein aber so gut gemästet – ich würde es für diese Skulptur sofort auf die Schlachtbank führen.

Seiko Ananta – scharf wie ein Schwert
01.04.2009Katana ist der Begriff für ein japanisches Langschwert, das sich durch eine geschwungene Form mit einer einfachen Schneide auszeichnet. Katana steht heute aber auch generell für „Schwert“ . Die Kunst des Schwertermachens ist in Japan legendär und geht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Die Ananta-Linie orientiert sich an dieser Tradition, sowohl handwerklich als auch bei der Form der Gehäuse.
Präzision, Handwerk, geschwungene Linien – alle diese Elemente sind ins Design der Ananta eingeflossen. Ein markantes Grundgehäuse bildet die Basis der Uhren. Darin integriert wird die eigentliche Uhr mit ihrer runden Form. Zeiger und Indexe sind messerscharf, an den Kanten poliert, auf den Oberflächen fein gebürstet. Der Rotor ist vom Handschutz der Schwerter inspiriert.
Ananta ist ein Begriff aus dem Sanskrit – er steht für das Unendliche. Das Entwicklerteam von Seiko hatte weitgehend freie Hand bei der Erschaffung der Ananta-Linie, es sollte einfach Handwerk auf höchstem technischen Niveau resultieren, so die Vorgabe, die „Uhr fürs Leben“. Entstanden ist eine ungemein hochwertige Kollektion von Uhren mit traditionellen automatischen Mechanikwerken und mit gewissen Modellen, die auf die nur von Seiko beherrschte SpringDrive-Technik setzen. Schon in den sechziger Jahren erzielten mechanische Seiko-Werke an Observatoriumswettbewerben in Genf und Neuchâtel Bestwerte. Seither hat der japanische Riese ständig an der Perfektionierung seiner Techniken gefeilt. Flaggschiff sind heute die nur in Japan (und, als einzige offizielle unabhängige Verkaufsstelle in Europa auch bei Uhrsachen in Bern) erhältlichen Modelle der Grand Seiko-Linie.
Die Ananta-Linie ist nun die erste Serie von Seikos im oberen Preissegment, die weltweit lanciert wird. Sie umfasst drei mechanische Kaliber, von denen zwei vollständige Neuentwicklungen sind. Seiko spricht selber von Superlativen in der Präzision, der langfristigen Zuverlässigkeit und der Gangreserve. So wie wir die Firma kennen, wird sie hier sicher nicht übertreiben – unsere Erfahrungen mit den Grand Seiko-Werken sind hervorragend. Nicht die komplexesten Zusatzfunktionen sollten das Ziel sein, sondern eine servicefreundliche, dauerhafte, robuste und solide Uhr.
Die Werke schwingen mit der Frequenz von 4 Hz, also mit 28’800 Halbschwingungen pro Stunde. Das 8R28-Chronographenwerk ist eine Konstruktion mit Schaltrad und einer vertikalen Kupplung. Das Kaliber 6R24 bietet eine doppelte retrograde Funktion für Kalenderdatum und Wochentag. Alle drei Werke benutzen die Seiko-eigene Legierung „SPRON 510“ für die Aufzugsfeder, für den Aufzug kommt das schon 1959 eingeführte „Magic Lever“-System zum Einsatz, das für eine besonders schnelle und effiziente Aufzugsleistung sorgt.
Aber auch die SpringDrive-Technik wurde der Ananta-Linie zugänglich gemacht. Das bereits legendäre Spring Drive-Chronographenwerk 5R86 ist bereits aus der Grand Seiko- und der SpringDrive-Kollektion ein Begriff. Auch das SpringDrive-Kaliber 5R66 mit zweiter Zeitzone wird verbaut.
Das Design der Uhren ist sehr eigenwillig und wird nicht allen gefallen. Die von uns aufgeschnappten Kommentare der Besucher am Stand von Seiko an der Baselworld schwankten zwischen grosser Begeisterung und harscher Ablehnung, kalt gelassen hat es hingegen niemanden. Die Uhren haben eine stattliche Grösse, liegen aber enorm gut am Arm, wie wir uns selber ausführlich überzeugen konnten. Die Ergonomen von Seiko haben hier brilliante Arbeit geleistet.

Das Volkstourbillon von Frank Jutzi
22.11.2008Er hat viel Erfahrung mit Tourbillons, hat sie schon in verschiedensten Varianten und Grössen als Einzelstücke angefertigt. Nun lanciert Frank Jutzi eine Armbanduhr mit einem von ihm überarbeiteten chinesischen Tourbillonwerk.
AHCI nennt sich ein besonders exklusiver Club von Uhrmachern – es ist die Académie des Horlogers Créateurs Indépendents, die Akdemie unabhängiger Uhrenkreateure. Die Namen der Mitglieder sind illuster: Vianney Halter, Paul Gerber, Svend Andersen, Felix Baumgartner, Philippe Dufour, um nur einige zu nennen. Auch der 45jährige Berner Frank Jutzi, Uhrmacher mit Leib und Seele, ist Mitglied der „Académie“. Schon im ersten Jahr seiner 1981 in Bern begonnen Uhrmacherlehre in Bern tüftelte der ehemalige Steiner-Schüler an seiner ersten eigenen Uhr, einer Sonnen-Monduhr mit skelettiertem Werk. Gleich nach der Lehre eröffnete Jutzi 1985 sein eigenes Atelier für die Restauration von antiken Uhren. Wann immer es die Zeit zuliess, arbeitete er zudem an eigenen Entwürfen.
1998 stellte Frank Jutzi seine Standuhr mit 2 Monaten Gangdauer und transparentem Werk erstmals am Stand der AHCI aus, damals noch im Status des Kandidaten. 2000 wurde er als Mitglied in die AHCI aufgenommen. Heute liegt sein Atelier im ländlichen Wichtrach im Berner Aaretal. Ein Besuch ist ein Erlebnis – neben Sumiswalder Pendulen hängen alte Regulatoren, auf den Tischen stehen „Capucines“, auf einem Uhrenbeweger drehen mehrere Armbanduhren, die gerade in der Kontrolle sind. Jutzi und seine Mitarbeiter decken ein breites Spektrum an Uhrenrestaurationen ab. In jeder freien Ecke, so scheint es, stehen noch Uhren, Bestandteile oder auch alte Maschinen. Letztere sind voll funktionsfähig und werden auch regelmässig eingesetzt. „Ich kann nichts wegwerfen“ sagt Jutzi. Nicht zuletzt dürfte daran auch sein ökologisches Gewissen mitbeteiligt sein. Nicht-Autofahrer Jutzi liefert schon mal eine Standuhr per Zug, so geschehen diesen Sommer, immerhin bis zu einem Kunden in St. Tropez.
2001: Das erste Jutzi-Tourbillon
Zur Jahrtausendwende hatte die unterdessen in argen Schwierigkeiten steckende Goldpfeil-Gruppe mit viel finanziellem Aufwand ein Projekt namens „Seven Masters“ lanciert, bei dem sieben ausgewählte Mitglieder der AHCI je ein spezielles Einzelstück und dazu eine kleine Serie von exklusiven Uhren herstellte. Auch Jutzi war einer der „Auserwählten“. In den Jahren 2000/2001 fertigte er im Rahmen dieses Projekts sein erstes Armbanduhren-Tourbillon.
Diese Komplikation gilt nach wie vor als die grösste Herausforderung für einen Uhrmacher. Die Idee hinter dem vom legendären Abraham Louis Breguet erfundenen Mechanismus ist es, die Gravitationskräfte der Erde zu kompensieren, die auf das Regulierorgan der Uhr einwirken. Darum werden die wichtigen Bestandteile Ankerrad, Anker und Unruh in ein Drehgestell, den so genannten Tourbillonkäfig, verbaut. Dieser dreht sich dann einmal pro Minute um die eigene Achse, die auf dem Sekundentrieb montiert ist. „Diese Konstruktion trieb mich fast zur Verzweiflung – es war eine dermassen komplexe Angelegenheit.“ Jutzi integrierte den Tourbillon-Mechanismus in ein exquisites historisches Formwerk aus den zwanziger Jahren, das entsprechend angepasst werden musste. Einmal mehr zeigte sich hier Jutzis grosse Liebe zur antiken Uhr. Das Ganze wurde in ein klassisches Tonneau-Gehäuse aus Weissgold integriert.
Nach einer längeren Tourbillon-Pause („Ich konnte das Wort nicht mehr hören“ sagt er heute mit etwas Distanz…) widmete er sich wieder dem „Wirbelwind“, das Thema liess ihn eben doch nicht los. Diesmal sollten die Konstruktionen jedoch wesentlich grösser werden: Eine auf 25 Stück limitierte Serie von Tischuhren mit 14-Tage-Werk, Regulator-Zifferblatt und Mondphasenanzeige. Jutzi hat mehrere Tisch- und Standuhren kreiert, laufend werden es mehr. Die Konstruktionen sind unterschiedlich und zum Teil sehr ausgefallen. Gewisse Einzelstücke basieren auch auf bestehenden Grundwerken, die Jutzi radikal modifiziert. Zur Zeit haben es ihm vor allem die „Mystérieuses“ angetan, Uhren bei denen der Mechanismus verborgen bleibt und dadurch – der Name sagt`s – etwas Mysteriöses ausstrahlen. Faszinierend ist seine letzte komplette Eigenkreation, eine Mystérieuse mit Tourbillon, die er 2008 an der Baselworld präsentierte. Bei diesen Uhren kommt immer auch der Kunsthandwerker Jutzi zum Zug: Die Statue der Frau, die das Zifferblatt hält, hat der vielseitige Macher selber entworfen und in Bronze gegossen.
Die Chinesen kommen
Bei einem Rundgang durch die Baselworld 2007, dem jährlichen Treffen der ganzen Uhrenbranche, entdeckte Jutzi mehrere chinesische Produzenten, die Tourbillonwerke anboten (dies neben unverblümt gezeigten Nachbauten von ETA-Werken). Auf Internet-Plattformen werden seit längerem Tourbillon-Uhren mit fantasievollen, französisch angehauchten und entsprechen nobel klingenden Namen feil gehalten, zu Discountpreisen. Die Qualität ist entsprechend. Jutzi war dennoch fasziniert und inspizierte die Werke akribisch. „Es gibt sie in den unterschiedlichsten Ausführungen. Das meiste ist von absolut dürftiger Qualität.“ Bei einem Hersteller hingegen staunte der Meisteruhrmacher, die Konstruktion war ordentlich, lediglich die Ausführung liess Sorgfalt und Liebe zum Detail vermissen. „Mir wurde aber rasch klar, dass diese Werke mit entsprechender Überarbeitung durchaus auch höheren Ansprüchen genügen könnten. Natürlich nicht auf dem Niveau der wirklichen „Haute Horlogerie“, aber in einem ehrlichen vernünftigen Preisrahmen, der es auch einem nicht ganz so begüterten Uhrenliebhaber ermöglichen würde, den Traum der Tourbillon-Uhr zu verwirklichen.“ Jutzi ist gespalten, was die chinesische Werkproduktion und Uhrenindustrie angeht. Er anerkennt erstaunliche Fähigkeiten, die in China innert relativ kurzer Zeit entstanden. „Man muss sich auch nicht wundern – schliesslich lagerte die Uhrenbranche schon vor Jahren gewisse Arbeiten in die Billiglohnländer aus. Bis sie unser Qualitätsniveau und -bewusstsein erreichen, wird es noch dauern, aber sorgen sollte sich die Schweizer Industrie schon.“
Exklusive Serie
Ende 2008 lanciert der nimmermüde Tüftler eine Kleinstserie einer Armbanduhr mit einem Tourbillon-Basiswerk aus China. Natürlich macht er sich damit nicht nur Freunde – die Branche beobachtet solche Aktivitäten mit Argwohn und ist mit der Klassierung „Nestbeschmutzer“ rasch zur Stelle. Jutzi kümmert dies nicht gross. „Mich interessiert gute Uhrmacherei, und das gibt es nicht nur in der Schweiz. Ich respektiere die geleistete gute Vorarbeit der Chinesen und gebe mein Bestes bei der Überarbeitung, damit daraus wirklich schöne Uhren entstehen. Ich stehe auch mit meinem Namen für das fertige Endprodukt hin und gewähre eine Garantie. “ Das würde Jutzi kaum tun, wenn er nicht von der Uhr überzeugt wäre.
Alt und neu kombiniert
Ein Thema zieht sich durch Jutzis Schaffen: Die Kombination von alt und neu. Seine Faszination für alte Uhren und alte Dinge ist augenscheinlich, wenn man in seinem Atelier steht. Einmal mehr kombiniert Jutzi auch bei diesem Projekt Antikes mit Neuem: In seinem unerschöpflich scheinenden Fundus fand er noch einige kleine echte Emailzifferblätter, die er einst aus einem Uhrmachernachlass noch in einer Schublade liegen hatte. Diese hatten genau die richtige Grösse, um nun in seinem „Volkstourbillon“ Verwendung zu finden. Mit viel Liebe drehte er in seiner Werkstatt eine stilvolle Umrandung für diese kleinen Preziosen, die dann auf dem Basiszifferblatt fixiert werden. Dieses wiederum ist aus Messing, wird von Hand fein graviert und danach vergoldet. Auch die klassischen gebläuten Breguet-Zeiger stammen „aus den Archiven“. Sie heissen übrigens wegen ihrer Form so, und nicht, weil sie von einer alten Breguet stammen.
Die Tourbillon-Uhren dürften rasch ausverkauft sein. Schon bevor das erste Exemplar fertig gestellt war, gab es die ersten fixen Bestellungen. Dies ist nicht erstaunlich: Ein echtes Tourbillon und dazu einen „echten Jutzi“ für einen noch knapp vierstelligen Frankenbetrag erstehen zu können, ist für einen echten Uhrenliebhaber schon äusserst verlockend…

Grande Seconde Ceramique Réserve de Marche – Traumuhr von Jaquet Droz
30.09.2008An der Baselworld 2008 wurde sie von Jaquet Droz erstmals präsentiert und war einer der Stars: Die Grande Sconde mit Gangreserveanzeige, das Ganze in einem schwarzen Keramikgehäuse.
Das Keramikgehäuse hat einen Durchmesser von 44 mm, Glasboden und ein Saphirglas. Im Innern tickt ein Jaquet Droz Cal. 4063D, basierend auf einem Werk von Frédéric Piguet, mit Goldrotor und einer stattlichen Gangreserve von 68 Stunden. Das schwarze Kautschukband verfügt über eine schwarz PVD-besichtete Stahlschliesse.
Die Uhr wird voraussichtlich ab Oktober 2008 bei Uhrsachen erhältlich sein.

Exklusiver geht’s kaum: eine Uhr aus Golfschlägern von Seve Ballesteros
26.09.2008Die Golflegende Severiano Ballesteros und Jaermann & Stübi haben auf der Basis der 2007 an der Baselworld eingeführten Golfuhr des Unternehmens ein ganz spezielles Highlight geschaffen. Eine Uhr deren Gehäuse aus den Golfschlägern geschmiedet ist, mit denen Seve Ballesteros 1991 das Chunichi Crowns Open gewann. Jedes Uhrengehäuse der auf 50 Stücke limitierten Serie, kann einem der von Seve gespielten Eisen zugeordnet werden, was diese exklusive Uhr noch einmaliger macht.
Das Chunichi Crowns Open ist Teil der Japan Golf Tour und wurde 1991 von Seve Ballesteros mit 275 Schlägen (5 unter Par) gewonnen. Die von ihm dabei gespielten Eisen 1 bis 9 sowie das Pitching Wedge und das Sand Wedge sind zu den 50 Uhrengehäusen für die limitierte Serie „Seve Ballesteros“ verarbeitet worden.
Mit viel Stolz und bübischer Freude präsentierten Urs Jaermann, Seve Ballesteros und Pascal Stübi (im Bild, v.l.n.r.) ihren Streich in noblem Rahmen in Zürich. Sie hätten sich in St. Andrews Link an einem Anlass kennengelernt, schildert ein sichtlich stolzer Urs „I’m the lousy golfplayer“ Jaermann den Anfang des etwas verrückten Projekts: „Unser Gespräch drehte sich rasch um die Golfuhr. Der Uhrenliebhaber Ballesteros war auf Anhieb von der Golfcounter-Komplikation begeistert. Ein Wort gab das andere, und spontan fragte ich ihn, ob er nicht Lust hätte, uns ein Schlägerset für eine Serie von Uhren zur Verfügung zu stellen“. Zum grossen Erstaunen von Jaermann willigte sein Golfidol ein.
Zurück in Zürich konfrontierte er seinen Geschäftspartner Stübi mit der Idee. „Ich bin mir von Urs ja einiges gewohnt – er strotzt nur von verrückten Ideen. Mit meinem technischen Background standen mir zuerst die Haare zu Berg. Gehäuse aus Golfschlägern zu machen kam mir vor wie aus alten Schrauben Rasierklingen produzieren zu wollen. Ich willigte aber ein und liess als erstes einen Golfschläger von einem Labor auf die Stahlqualität analysieren. Zu meinem Erstaunen war die Stahlqualität sehr gut, und ich hatte keine technische Ausrede mehr.“
Die Produktionsprobleme begannen aber erst jetzt. „Es ist einfach, jemanden zu finden, der 50 Tonnen Stahl schmilzt. Eisenhütten sind für grosse Mengen ausgelegt. Aber 11 Golfschläger einschmelzen…. darauf wartet niemand.“ Man fand dann Partner in Deutschland. Die Verarbeitung wurde in einem aufwändigen und mehrstufigen Verfahren in Zusammenarbeit mit der Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen und Dr. Bergfeld Schmiedetechnik in Solingen entwickelt.
Zuerst mussten die Schlägerköpfe genau analysiert werden, um eine Legierung zu erhalten, die den Anforderungen an ein Uhrengehäuse entspricht und einen lunkenfreien Guss ermöglicht. Nach umfangreichen Tests konnten die Schläger portioniert und verschmolzen werden, so dass von jedem Golfschläger ein Gussstück entstand um die Schläger später dem Uhrengehäuse zuzuordnen. Anschliessend wurden die Gussstücke bei etwa 1200° C zu Uhrengehäusen geschmiedet.
Dieses Verfahren ermöglicht es, jeder Uhr eines der Eisen zuzuordnen, mit denen Severiano Ballesteros das Chunichi Crowns 1991 gewonnen hat. Und damit kann jeder Besitzer einer „Seve Ballesteros“ auch ein spezifisches Eisen mit auf seine Golfrunde nehmen.
Das Modell „Seve Ballesteros“ hat wie alle Modelle von Jaermann & Stübi ein Automatikwerk sowie eine patentierte mechanische Golf-Counter-Komplikation. Diese ermöglicht es, die Schläge pro Loch zu zählen, das Score aufzuaddieren und dieses nach der Golfrunde mit dem Handicap zu vergleichen.
Das Zifferblatt, die Drehlünette wie auch die gesamte Verpackung sind in Dunkelblau gehalten, der Lieblingsfarbe von Seve Ballesteros. Jede Uhr ist einzeln nummeriert und auch der jeweilige für das Gehäuse verwendete Golfschläger ist im Boden eingraviert. Ein von Seve Ballesteros unterschriebenes Zertifikat bescheinigt zusätzlich die Echtheit der verwendeten Schläger.
Das Modell „Seve Ballesteros“ wird ab Anfang November unter anderen auch bei Uhrsachen in Bern zum Preis von CHF 21’500.- erhältlich sein. Reagieren Sie rasch, wenn Sie sich eine der wohl exklusivsten Uhren auf dem Markt sichern wollen.
Severiano Ballesteros: Der Jahrhundertgolfer
Severiano Ballesteros ist wahrscheinlich der talentierteste Golfspieler aller Zeiten und der Spieler mit dem grössten Charisma und der grössten Passion. Er gewann fünf Majors, mehr als 80 internationale Turniere und war der Motor für das Comeback des Europäischen Ryder Cup Teams. Er ist auch der Golfer, für den es keine unmöglichen Schläge gab. Sei es von Bäumen, aus Büschen, aus dem Rough oder von einem Parkplatz.
Vor seinem grandiosen British Open Sieg von 1988 publizierte „Golf World“ einen Artikel über Seve Ballesteros und wie er die letzten sechs Löcher in Royal Lytham St. Anne 1979 bei seinem ersten Open Sieg gespielt hatte. Es gab die konventionelle Route und „the Seve Way“, eine Definition seines spezifischen eigenen Stils. Unvergesslich war wohl, wie er das 16. Loch spielte. Mit einem Driver anstatt eines konventionellen Eisens auf dem kürzest möglichen Weg. Der Ball landete auf einem Parkplatz, von wo aus Seve das Green so platziert anspielte, dass er zum Birdy einlochen konnte.
Emotionen und ein brillantes kurzes Spiel waren seine besten Verbündeten auf dem Golfplatz. Seine magischen Schläge beruhten auf jahrelanger Übung , die als Junge an den Stränden von Pedrena begann, wo er Steine mit einem selbstgebauten 3er-Eisen schlug. Während seiner Top-Zeit war niemand besser im Erspielen von tiefen Scores. So gewann er sechsmal die Harry Vardon Trophy für das durchschnittlich niedrigste Score auf der European PGA Tour.
Das vielleicht grösste Vermächtnis von Seve Ballesteros ist, dass er europäisches Golf auf die Weltbühne gehoben hat, indem er das Europäische Ryder Cup Team prägte, anfeuerte und konkurrenzfähig machte. Mit Seve gewannen die Europäer 1987 zum ersten Mal den Cup auf amerikanischem Boden. Und Seves` Unerschrockenheit und Kampfgeist machten ihn zu einem der grössten Match Play-Spieler aller Zeiten.
Jaermann & Stübi: die junge Marke mit dem Golf-Counter Uhr
Eine Uhr mit mechanischem Golf-Counter und hochstehendem Automatikwerk haben Jaermann& Stübi 2007 an der BaselWorld lanciert. (Tick different berichtete) Heute blicken sie auf ein arbeitsintensives und erfolgreiches erstes Geschäftsjahr zurück. Eine für die beiden Unternehmer überraschend grosse Anzahl Uhrenkenner und Golfer haben Interesse an der eleganten Uhr bekundet. 2008 warten Jaermann & Stübi mit einer weiteren exklusiven Innovation auf.
Das Jahr 2007 war für die beiden Jungunternehmer intensiv. Sie hat Urs Jaermann und Pascal Stübi die Gewissheit gegeben, dass ihre Idee richtig war. Seit ihrem Markteintritt im April 2007 ist es Jaermann & Stübi gelungen, ein gutes Distributorennetz, mitunter nicht nur in der Schweiz, aufzubauen. Im Jahr 2007 vertrieben bereits einzelne Händler die Uhr in Frankreich, Deutschland und den U.S.A.. Seit 2008 wird der US-Markt, Japan und Osteuropa von festen Distributoren bearbeitet. Der Fachhandel und die Distributoren sind vom Produkt überzeugt. Heute, vor der Golfsaison 2008, sind beinahe doppelt so viele Exemplare von der Uhr, die nach jeder Runde den eigenen Score anzeigt und mit dem Handicap vergleicht, verkauft als bei der Lancierung geplant. Die beiden Partner sehen dem zweiten Geschäftsjahr mit hoher Zuversicht entgegen.
Die Uhr mit der patentierten Golf-Counter Komplikation und dem modernen Automatikwerk A10 kommt bei Golfern, wie bei Uhrenliebhabern an. Sie bietet eine – auf dem Markt – einmalige und exklusive Funktionen an: Das Zählen von Golfschlägen pro Loch, das Addieren des gesamten Scores pro Runde und der Vergleich mit dem Handicap. Der Golf-Counter ist ein nützliches Element, dazu ist die Komplikation so ambitiös und neu, dass sie den Uhrenkenner überzeugt. Die ganze Kollektion ist mit ihren diversen Ausführungen elegant, sportlich und passt auch an ein schmaleres Handgelenk einer Frau.
Der letzte Coup des Jungunternehmens ist die Zusammenarbeit mit St Andrews Links, der Geburtstätte des Golf sowie mit der Golflegende und achtfachem Majors Sieger Seve Ballesteros.

Interessante Datumslösung: Meistersinger Perigraph
29.08.2008Ein Datum im Fenster, eine Datumsanzeige mit Zeiger – sehr oft wird das Thema nicht variiert. Mit einer bemerkenswerten Variation verblüfft uns nun Meistersinger.
Perigraph heisst das neue Modell. Es basiert auf der erfolgreichen Einzeigeruhr des kleinen, aufstrebenden deutschen Uhrenunternehmens. Sie legte den Grundstein für den Erfolg des Gründers Manfred Brassler, der umtriebig neue Ideen umsetzt. Ein einfaches Fensterdatum wäre zu banal gewesen, und ein Zeigerdatum hätte den „Einzeigergedanken“ verwässert. Darum kommt beim Perigraph eine Datumsscheibe zum Einsatz, die offen gezeigt wird. Ein kleiner Index bei 12 Uhr zeigt das aktuelle Datum. Geniale Lösungen sind oft einfach.
Die Uhr kommt in den bekannten und bewährten Meistersinger-Farben und -Grössen auf den Markt: Zifferblätter in schwarz, beige (oder nobler auch „elfenbein“ genannt) und silber, Durchmesser von 43 oder 38 mm. Bei Uhrsachen vom Herbst 2008 an erhältlich, auch mit dem neuen Stahlband.

Vulcain: Das automatische Weckerwerk
09.04.2008Als Première können wir Ihnen einen Meilenstein der Manufaktur Vulcain präsentieren: Das erste automatische Cricketwerk mit der legendären Weckfunktion.
Das bewährte Weckerwerk der Cricket ist einer der Grundsteine für den Erfolg der Manufaktur Vulcain aus Le Locle. Rechtzeitig zum 150. Geburtstag der Firma präsentiert sie nun eine Automatikversion, das Kaliber V-20. Ein Leckerbissen aus 221 Einzelteilen, auf den die Weckerfreunde schon lange warten. Dieses Warten hat sich gelohnt – das neue Werk steht unmittelbar vor der Serienproduktion. Die ersten Uhren mit dem neuen Werk sollten im Herbst 2008 bereit sein.
Wie das Handaufzugswerk V-10 misst es 12 Linien im Durchmesser und schlägt mit einer Frequenz von 18`000 Halbschwingungen pro Stunde. Mit dem neuen Rotor aufgezogen wird das Federhaus des Uhrwerks; dasjenige des Weckers wird nach wie vor manuell gespannt. Dies macht Sinn – denn man braucht den Wecker nur dann aufzuziehen, wenn er tatsächlich benötigt wird.
Der Bimetallrotor ist unidirektional, zieht also nur in einer Richtung auf. Eine spezielle Führung auf der Werksplatine sorgt dafür, dass die Schwungmasse im Fall eines Schlages gut abgestützt wird.
Neu beim automatischen Werk ist auch die Konstruktion des Hämmerchens, das für den unverkennbaren Weckton der Cricket verantwortlich ist. Standard bei Vulcain-Werken ist hingegen das bereits 1946 patentierte Exactomatic-System. Diese spezielle Art der Lagerung der Unruh vermeidet die so genannten Lagenfehler und sorgt so, dank einer relativ einfachen, aber effizienten Konstruktion, für eine deutliche Verbesserung der Präzision.

Frisch enthüllt: Mazzuolis Contagiri
08.04.2008Schon 2007 tauchten erste Bilder des Contagiri von Giuliano Mazzuoli auf. Jetzt wird die Sache konkret, Preise und technische Daten sind bekannt.
Wer sich an der Baselworld bei Giuliano Mazzuolis Stand einfindet, sieht zuerst einmal ein umwerfendes Auto: ein knallroter Alfa Romeo 8C, der Supersportwagen aus Mailand, zieht die Blicke auf sich. Dies hat einen guten Grund: Der „Contagiri“, der „Tourenzähler“ von Mazzuoli erscheint in einer limitierten Serie“Alfa Romeo 8C Competizione“ von 500 + 1 Stück. Diese Ausgabe wird exklusiv den Eigentümern eines solchen Wagens zugänglich sein. Das Zifferblatt ist denn auch die genaue Abbildung des Tourenzählers des 8C. Das Gehäuse ist eine Kombination von Weissgold und Carbon. Natürlich stimmt die Gehäusenummer mit derjenigen des entsprechenden Fahrzeugs überein.
…und das Auto dazu:
Auch für den „normalen“ Alfa-Fahrer (oder -Aficionado) ist aber eine Contagiri vorgesehen. Diese wird 1050 Mal produziert werden (1050 Alfa GTA wurden hergestellt….). Auch dieses Modell trägt den Alfa Romeo-Schriftzug auf dem Zifferblatt. Bei dem kleinen Dreieck unten auf dem Zifferblatt wird der jeweilige Status der Uhr angezeigt. In der neutralen, normalen Position erscheint bei diesem Modell ein Quadrifoglio, das legendäre vierblättrige Kleeblatt.
Das Gehäuse ist aus Stahl, mit einer schwarz PVD-beschichteten Seite.
Eine weitere Serie kommt ohne Alfa Romeo auf den Markt. Der reine Mazzuoli-Contagiri wird mit schwarzem und weissem Zifferblatt lieferbar sein. Statt des Kleeblatts trägt sie das Logo von Mazzuoli bei der Statusanzeige.
Eine ganz spezielle Serie von 25 Stück gibt es zusätzlich. Diese werden nur an Auktionen zugunsten der Stiftung „Hole in the wall camps“ der rennfahrenden Schauspielerlegende Paul Newman verkauft werden. Mazzuoli und Newman sind seit längerer Zeit befreundet (gemeinsame Passionen verbinden….).
Der weisse Contagiri trägt die Unterschrift von Paul Newman auf dem Zifferblatt.
Hier noch einige technische Details:
Das Werk basiert auf einem Soprod A10 mit automatischem Aufzug und einer Gangreserve von 42 Stunden. Aufgezogen wird die Uhr nicht über eine Krone, sondern über die Lunette. Dazu muss zuerst der ins Gehäuse integrierte Hebel auf der rechten Seite um eine Stufe ausgeklappt werden. Inder zweiten Stufe wird dann die Lunette zum Verstellmechanismus.
Die Uhr ist eine retrograde Einzeigeruhr. Der Stundenzeiger wandert also bis 12 Uhr und springt dann auf die Ausgangsposition zurück. Weil der Minutenzeiger vollständig fehlt, kann die Zeit nur auf einige Minuten genau abgelesen werden. Der kleine Zeiger mit der roten Spitze ist im Prinzip ein Sekundenzeiger, dient aber vor allem der Kontrolle, ob die Uhr läuft oder nicht.
Das Gehäuse gibt es in zwei Varianten: aus Kohlefaser (Carbon) mit einem Boden und der Lunette aus Weissgold oder aus schwarz PVD-beschichtetem Stahl mit Lunette und Boden aus Stahl. Es misst 44 mm im Durchmesser und 13.3 mm in der Höhe. Das Saphirglas ist leicht bombiert. Das Kautschukband gibt es in schwarz oder rot, mit Dornschliesse oder – auf Wunsch – einer Faltschliesse in Stahl oder Gold.
Das Contagiri-Modul ist eine Mazzuoli-Exklusivität und besteht aus 131 Komponenten. Es vereint 3 weltweite Patente in sich.
Die Preise liegen bei 16400 Euro für die Stahl- und 23000 Euro für die Carbon-/Weissgoldversion.
2008 werden voraussichtlich lediglich insgesamt 200 Stück der Uhr produziert – wir werden alles daran setzen, eine oder mehrere davon zu kriegen.

Sarpanevas Korona – noch ein Geniestreich aus Finnland
06.04.2008Wir berichteten schon mehrmals über den finnischen Meisteruhrmacher Stepan Sarpaneva. In kleinsten Auflagen entstehen in seinem Atelier in Helsinki gewagte Kreationen. Meisterlich geht er nicht nur mit Uhrwerken um – besonders seine Designs und deren technische Umsetzung suchen ihresgleichen.
Unvergessen sind die Modelle Oiva und Loiste. Einige wenige glückliche Uhrsachen-Kunden wurden Besitzer dieser exklusiven Stücke. Nach Basel 2007 kam die Supernova, nur 10 Stück wurden davon produziert.
Stepan Sarpaneva lanciert jetzt ein neues Modell namens Korona. Wieder ist es ein Lehrstück in Metallbearbeitung. Die Korona kommt in zwei Ausführungen: als „einfache“ Dreizeigeruhr mit Datum Korona K2 und zusätzlich mit einer eigenwilligen Mondphase als Koronoa K3.
Die Gehäuse sind in einer reinen Stahlvariante oder zusätzlich mit der extraharten schwarzen Beschichtung im „Diamond like coating“-Verfahren (DLC) lieferbar.
Die Zifferblätter sind enorm aufwändig gemacht, über den Herstellungsprozess will der finnische Tüftler nicht allzuviele Worte verlieren. Die Tradition der Verschwiegenheit ist der Branche und den Finnen offenbar eigen. Eigene Wege geht er bei der Koronoa K2 mit der Datumsscheibe. Diese besteht aus Stahl, und die Datumszahlen sind – die zweistelligen übereinander angeordnet – daraus mit High-Tech-Lasertechnik herausgeschnitten.
Der Mond mal anders: statt den immer gleichen Gesichtern ein finnischer Look:
Das Werk basiert auf einem 11-Linigen Soprod A10 mit 42 Stunden Gangreserve, automatischem Aufzug und 28’800 Halbschwingungen (4 Hz). Die Grundplatine des Werks musste verändert werden, um die stählerne Datumsscheibe aufnehmen zu können.
Speziell ist auch der Rotor für den Aufzug. Er ist skelettiert und umfasst eigentlich die ganze Fläche der Werkrückseite. An einigen Stellen wurden Gewichtselemente angebracht (bei der K3 zusätzlich der Mond), damit der Rotor auch richtig aufzieht. „Glaub‘ mir, es funktioniert bestens“ sagt Stepan Sarpaneva auf unsere leicht skeptische Rückfrage.
Wir haben uns vorerst einmal je eine Korona sichern können. Die Produktion ist wiederum sehr klein – die Uhren sind dieses Mal allerdings nicht limitiert. Auf spezielle Wünsche kann übrigens noch eingegangen werden. Die eine unserer Koronas wird auf jeden Fall das schwarze Gehäuse haben und – exklusiv – Zeigerspitzen in unserer Hausfarbe orange.

Glycine Lagunare 3000: starker Taucher mit interessanten Features.
04.04.2008Dicker, grösser, tiefer. Das Hochrüsten bei den Taucheruhren kennt fast keine Grenzen mehr. Glycine überzeugt mit ihrem neuesten Lagunare-Modell, dem Lagunare Certified Chronometer 3000.
Gut – neben der neuen Rolex Sea-Dweller Deep Sea haben die anderen Taucheruhren einen schweren Stand. Aber 3000 Fuss oder 1000 Meter sind auch nicht ohne. Das neueste Mitglied der Lagunare-Familie aus dem Hause Glycine schafft diese Tiefe spielend. Nur 300 Exemplare dieses wuchtigen Zeitmessers werden gebaut, im Gegensatz zur „Massenware“ aus Genf.
Im Innern des antimagnetischen Gehäuses tickt ein erstklassig finissiertes C.O.S.C.-zertifiziertes, bewährtes Automatikwerk 2824 aus dem Hause ETA. Ein Mantel aus Weicheisen verleiht dem Extremtauchermodell Antimagnetismus-Eigenschaften, die die gängigen Normen bei weitem übertreffen.
Speziell sind auch die Funktionalitäten der markanten Uhr. Die – selbstverständlich verschraubte – mittlere Krone wird durch einen neu konzipierten Aufklappdeckel geschützt, den das Glycine-Logo stilecht ziert. Die obere Krone dient der Fixierung der – wie es sich für eine Taucheruhr nicht anders gehört – einseitig drehbaren Lunette. Ein cleverer Zug für die Sicherheit des Extremtauchers.
Safety First – dies war auch die Devise für das Heliumventil, das auf der Gehäuseseite bei der 9-Uhr-Position integriert ist. Es verhindert Probleme beim Tieftauchen mit Heliumgemisch – das Gas kann sonst unter Umständen nicht entweichen. Ein ganz besonderes Feature in diesem Zusammenhang (unseres Wissens bisher noch von niemandem so eingesetzt – Roger Rüegger wird uns sonst bestimmt korrigierend ergänzen*) ist die zusätzliche manuelle Bedienung dieses Ventils, die über die ebenfalls geschraubte Krone bei 4 Uhr erfolgen kann. Wenn es denn sein muss.
*Nachtrag: Er hat uns korrigierend ergänzt. Der nimmermüde Roger Rüegger hat bei seinem Besuch bei Glycine-Chefin Katherina Brechbühler herausgefunden, dass es bei 4 Uhr ein ZWEITES Heliumventil gibt, das durch Aufschrauben von Hand bedient werden kann.

Limitierte Jubiläumsedition: 100 Jahre Max Bill
03.04.2008Zum 100. Geburtstag von Max Bill lanciert Junghans eine Jubiläumsedition der Uhren mit dem klassischen Design aus den fünfziger Jahren.
„Die Form folgt der Funktion“. Getreu dem Leitspruch des Bauhaus entwickelte der legendäre Schweizer Künstler, Architekt und Gestalter Max Bill Ende der fünfziger Jahre Max Bill eine Uhrenserie für die Firma Junghans. Zuerst waren da die Wand- und Küchenuhren, 1962 setzte er zum grossen Wurf einer Armbanduhrenkollektion an.
Diese Kollektion wird seither im Design weitgehend unverändert produziert – und mit Erfolg verkauft.
Es lag nahe, dass 2008 zum hundertsten Geburtstag des grossen Künstlers eine Jubiläumsedition lanciert werden würde. An der Baselworld 2008 wurde diese nun von Junghans vorgestellt. Je 100 Exemplare von sechs verschiedenen Modellen (siehe Bilder unten) werdem produziert. Ganze 10 solcher Sets sind für die Schweiz reserviert. Wir konnten uns zwei davon sichern. Reagieren Sie also rasch, wenn Sie sich eines dieser raren Stücke sichern wollen.
Die Jubiläumsuhren tragen die Unterschrift von Max Bill auf den Zifferblättern. Die Stahlmodelle werden mit einem feinen, längenverstellbaren Milanaiseband ausgeliefert. Die vergoldeten Modelle werden auf einem feinen Lederband getragen. Den Boden des Gehäuses ziert eine Lasergravur mit dem Portrait des Meisters.

Wristmaster – Das Chronoswiss-Rallye-Set für den Arm
03.04.2008Jede Baselworld bietet zuhauf neue Uhren. Und jedes Jahr gibt es neue Modelle, die uns so richtig zum Staunen bringen. Unser Liebling dieses Jahr: Die Wristmaster von Chronoswiss.
Die Liebe von Chronoswiss-Gründer zu alten Autos ist bereits legendär. Mit Freude und Stolz nimmt er an Oldtimer-Rallyes teil, dies mit Fahrzeugen, die auch Nicht-Autophile den Kopf umdrehen lassen. Schon länger bietet er darum ein stilvolles Rallye-Set namens Bordmaster an.
Nun gibt es aus dem Hause Chronoswiss das erste Rallye-Set fürs Handgelenk. Ja, Sie lesen richtig. Dass die Uhren zur Zeit immer grösser werden, ist ein wohl kaum mehr rückgängig zu machender Trend. Dass es aber gleich imposante Dimensionen von 84 x 42 mm werden – damit haben auch wir nicht gerechnet. Lang aber wagt es und bringt eine wirklich richtig exotische Uhrenkombination auf den Markt. Wristmaster heisst das Teil, das gleich zwei Uhren umfasst. Auf der linken Seite ist dies eine „normale“ Dreizeigeruhr mit Datum, basierend auf dem ETA-Kaliber 2892-2, aber in bester Chronoswiss-Manier bearbeitet und veredelt. Auf der rechten Seite die Stoppuhr, basierend auf dem Valjoux 7750-Kaliber, aber von Chronoswiss stark modifiziert und darum den Naen C.751 tragend. Damit stoppt der Rallyefahrer die Zeiten bis zu 12 Stunden mit einer Genauigkeit von einer Achtelsekunde.
Das erstaunlichste am Ganzen: Die Uhr ist angenehm zu tragen – auch wenn das auf den ersten Blick nicht so aussieht.
Das Alligatorband dürfte dem Bandproduzenten einiges Kopfzerbrechen beschert haben. Und ersetzen möchte man es auch nicht jeden Tag müssen….
Hier noch eine Grossansicht der linken Uhr. Man beachte die subtile Konstruktion der Grundplatte.
Natürlich haben wir für unsere Kunden gleich eine dieser einmaligen Doppeluhren bestellt. Geliefert sollte sie noch 2008 werden. Der Preis liegt im fünfstelligen Frankenbereich – gerne teilen wir ihn Ihnen auf Anfrage mit.

Neue Chronographen von Meistersinger
03.04.2008Nach dem Monographen folgt bei Meistersinger nun die Erweiterung der Chronographenkollektion mit den Modellen Singular und Chronoskop.
Der Monograph war die erste Meistersinger mit Stoppfunktion. Vielen war sie aber etwas zu „überladen“. Diese Bemerkungen scheint sich nun Meistersinger-Gründer und -Gestalter Manfred Brassler zu Herzen genommen haben. Mit dem Modell „Singular“ bringt er nun einen gelungenen Einzeiger-Chrono auf den Markt.
Das Thema „Reduktion“ war beim Grosserfolg Einzeigeruhr bestimmend. Sehr reduziert ist darum jetzt auch der „Singular“. Neben dem Stundenzeiger für die normale Zeitanzeige gibt es nur noch ein Hilfszifferblatt bei 12 Uhr, auf dem ein Minutenzeiger bis 30 Minuten anzeigt, sowie den Sekundenzeiger der Stoppuhr.
Dem Wunsch nach einem „herkömmlichen“ Chronographen entspricht das „Chronoskop“. Es übernimmt die gelungene Gestaltung der Meistersinger-Uhren und dürfte auch bei einem breiteren Publikum Erfolg haben.
Beide Meistersinger-Chronographen werden vom Valjoux 7750-Chronographenwerk angetrieben.

24-Stunden-Einzeigeruhr von Jaquet Droz
02.04.2008Mit der Einzeigeruhr schuf die deutsche Firma Meistersinger etwas wie eine eigene Kategorie von Uhren. Natürlich nahmen sich auch andere Hersteller dieses Themas an. Die wohl nobelste Variation präsentiert nun die feine Firma Jaquet Droz aus La Chaux-de-Fonds.
Ein Traum aus Weissgold und Email ist das 24-Stunden-Einzeigermodell von Jaquet Droz. Ein Traum, der nur 88 Besitzern oder Besitzerinnen vergönnt sein wird – die Auflage ist, wie oft bei der innovativen Manufaktur, streng limitiert.
Kann man bei den herkömmlichen 12-Stunden-Einzeigermodellen die Uhr noch auf 2-3 Minuten genau ablesen, braucht es beim Jaquet-Droz-Modell doch eine gewisse Nonchalance im Umgang mit der Zeit. Man darf vermuten, dass man diese aber an den Tag legen kann, wenn man sich das exklusive Modell mit Emaille-Zifferblatt und Weissgoldgehäuse leisten kann. Der Preis liegt etwas über CHF 20’000.- Das Werk ist übrigens – ganz wie man es sich von Jaquet Droz gewohnt ist, automatisch und vom Feinsten. Wer mehr Zeit hat, muss sich vermutlich auch weniger bewegen – darum verfügt es über eine Gangreserve von stattlichen 68 Stunden.

Der Régulateur 24 – Hommage an ein Erfolgsmodell
02.04.200825 Jahre jung ist die Marke Chronoswiss – zu diesem Jubiläum gönnt sie sich und ihren treuen Freunden eine Neuinterpretation des Régulateurs, diesmal mit 24-Stunden-Anzeige.
Vor 20 Jahren kam der Régulateur auf den Markt, die erste Armbanduhr, die die Anordnung der Zeiger von den legendären Uhren aus den Observatorien übernahm. Noch heute ist der Régulateur unbestritten das bekannteste und meistverkaufte Chronoswiss-Modell.
Nun erweist Chronoswiss-Gründer Gerd-Rüdiger Lang seinem Flaggschiff die Reverenz in Form des Régulateur 24. Diese limitierte Jubiläumsuhr kommt in einer etwas zeitgemässeren Grösse und mit einem neuen Gehäuse auf den Markt. Es misst 40 Millimeter im Durchmesser und verzichtet auf eines der Erkennungszeichen von Chronoswiss, die kanellierte Lunette (die nicht jedermanns Sache ist.) Typisch hingegen ist die grosse Zwiebelkrone.
Neu am Régulateur 24 ist – man kann es am Namen erraten – die 24-Stunden-Anzeige.
Angetrieben wird die Uhr vom Chronoswiss-Kaliber C.112. Die Ursprünge dieses 13-linigen Handaufzugswerks reichen zurück bis ins Jahr 1952, als das Werk unter dem Namen Marvin 700 seinen Einstand gab. Nachdem die Quarzuhren-Revolution das Aus für die Produktion gebracht hatte, gelangte der verbleibende Rest ins Eigentum der Münchner Uhrenfabrikation Chronoswiss, wo er als Basis für eigene Kaliber wie dasjenige im Régulateur 24 dient.
Hier noch der „Seelenverwandte“ – der Grand Régulateur, mit „herkömmlicher“ Anzeige von 12 Stunden:

Airman Special II – 100 Uhren für Puristen
28.01.2008Lange erwartet – endlich da: das neue Airman-Modell von Glycine als limitierte 24-Stunden-Ausführung. Eine Uhr für Puristen.
Airman Special II heisst die Uhr, die nur in hundert Exemplaren gebaut wird. Das Design erinnert an die Pionierzeiten in den 50er Jahren, als Glycine die ersten Weltzeituhren entwickelte. Glycine-Fans lieben diese Airman-Modelle der ersten Stunde noch heute ganz besonders: funktionale Uhren ohne Schnickschnack und Zusatzfunktionen.
„Diesen Liebhabern von Glycine-Uhren der ersten Stunde fühlen wir uns verpflichtet, und genau für sie haben wir die Airman Special II entwickelt“, sagt die kreative Glycine-Chefin Katherina Brechbühler. Das Modell mit reiner 24-Stunden-Anzeige und zwei Zeitzonen hat einen Durchmesser von 42 Millimetern – für Glycine eine eher kleine Uhr. Die Zeiger und die Drehlünette sind der Optik aus den Airman-Anfangszeiten nachempfunden. Die 24-Stunden-Anzeige ist zwar am Amfang etwas gewöhnungsbedürftig, da die Stundenwinkel anders sind, als man es kennt. Nach einigen Tagen ist es aber so, dass man die Uhr liest, wie wenn man nie etwas anders gekannt hätte. Das Datum wird mit einer Lupe im Saphirglas extra hervorgehoben.
Aussergewöhnlich ist das Zifferblatt mit dem Stand von 12 Uhr oben und 24 Uhr unten. „Oft ist es umgekehrt, doch entspricht diese Platzierung hier dem Sonnenstand: Am Mittag steht die Sonne schliesslich am höchsten Punkt, um Mitternacht ist sie unten“, erklärt Katherina Brechbühler. Wer die Uhr umdreht, sieht durch den Saphirglasboden den schön finissierten Rotor des Eta-Werks 2893-2 mit Genferstreifen und Airman-Gravur.
Die Uhr ist bis 200 Meter wasserdicht und kommt in einer Luxus-Holzbox mit Metall- oder Lederband. Sie kostet unter 2000 CHF. Wie immer bei Glycine ist das Preis-/Leistungsverhältnis exzellent, es gibt viel Uhr fürs Geld.
Nur 100 Exemplare weltweit werden gebaut – es empfiehlt sich also, sich mit einer Bestellung zu beeilen, da diese Kleinserien in der Regel sehr rasch ausverkauft sind.

Wahre Klassiker: Max Bill-Uhren von Junghans
27.01.2008Max Bill könnte 2008 seinen hundertsten Geburtstag feiern. In den sechziger Jahren kreierte der legendäre Architekt und Künstler eine Uhrenserie für Junghans, die bis heute produziert wird. In Anlehnung an seine frühreren Entwürfe gestaltete Junghans einen schlichten Chronographen.
Die Uhren von Max Bill sind zu wahren Klassikern geworden – seit 1962 behaupten sie sich auf dem Markt mit nahezu unverändertem Aussehen. Bis 2005 gab es sie mit Handaufzugswerk und verschiedenfarbigen Zifferblättern, alle mit dem für heutige Verhältnisse eher kleinen Durchmesser von 34 Millimetern.
Nachdem die kleine Kollektion 2005 um eine Automatikversion mit 38 Millimeter Durchmesser erweitert wurde, gelangte 2007 auch noch ein Chronograph auf den Markt. Dieser verwendet das weit verbreitete automatische Valjoux 7750-Werk der Swatchgroup-Tochter ETA.
Das Chronoscope gibt es in den Zifferblattfarben weiss und schwarz. Beiden gemeinsam ist die filigrane, äusserst sorgfältig gestaltete Skala auf dem Zifferblatt mit den charakteristischen kleinen Leuchtpunkten für die Nachtablesbarkeit. Bei der 3-Uhr-Positon wird in einem kleinen Fenster das Datum angezeigt.Wie bei den anderen Max Bill-Uhren kommt auch hier ein gewölbtes Plexiglas zum Einsatz. Das polierte Stahlgehäuse mit lediglich 40 mm Durchmesser erteilt dem „grassierenden Grössenwahn“ eine deutliche Absage. Durch den Verzicht auf die Anzeige der laufenden Sekunde, die normalerweise bei 9 Uhr platziert wird, wirkt das Zifferblatt ruhend und aufgeräumt. Die Uhr erscheint dank der schmalen Lunette zudem wesentlich grösser, als sie ist.
Zu Bills Zeiten waren Chronographen noch nicht so populär wie heute, das Design stammt also nicht vom Meister selber. Wir sind uns aber sicher, dass die Gestaltung des Chronoscopes durchaus „im Sinn des Erfinders“ ausgefallen ist. 2008 könnte Max Bill seinen hundertsten Geburtstag feiern – er würde sich bestimmt darüber freuen, dass seine Uhren zu wahren Klassikern geworden sind.
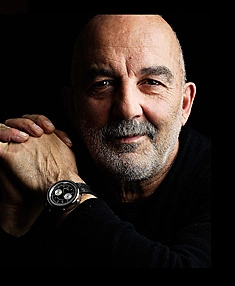
Der Manometro – Italiens neueste Kultuhr
15.09.2007Fast kein Designer kommt früher oder später um das Thema Uhr herum – zu gross ist die Verlockung, ein Kultobjekt schaffen zu können. Erst recht in Italien, dem Land der Uhrennarren.
Der italienische Designer Giuliano Mazzuoli konnte sich die Uhr auch nicht verkneifen. In den frühen siebziger Jahren hatte er von seinem Vater eine Firma übernommen, die für die Florentiner Lederhersteller Adressbucheinlagen und andere Spezialitäten aus Papier herstellte. Der Sohn modernisierte, krempelte um und erweiterte das Sortiment. Der grosse Wurf gelang ihm in den Neunzigern mit einer Agenda, die wegen ihrer Gestaltung innovativer und cooler war als andere auf dem Markt. Selbst das legendäre New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) liess von Mazzuoli Agenden auf Mass designen und produzieren. Kurz nach der Jahrtausendwende folgte eine Kollektion von Schreibinstrumenten – auch sie wurden Kult. Besonders natürlich der „Moka“-Stift, in seiner Form den italienischen Espressomaschinen nachempfunden (ja, denen aus Aluminium, an denen man sich so gerne verbrennt).
Er designe seine Objekte nicht – er begegne ihnen sagt der verschmitzte Italiener von sich. So sei die „Moka“-Linie aus einem Gekritzel während eines Telefongsprächs entstanden, und erst später habe er die Assoziation zu den säuberlich aufgereihten Kaffeemaschinen in der Küche seiner Grossmutter gehabt.
Die Inspiration: Ein Blutdruckmessgerät
Und dann eben die Uhr. Während Jahren hatte er an Uhrendesigns herumstudiert, Magazine und Kataloge zuhauf verschlungen. Ideen gehabt und wieder verworfen. Mazzuoli kam zum Schluss, dass ihn alle diese Quellen letztlich nur daran hindern würden, etwas wirklich neuartiges zu machen. Kurzerhand entsorgte er das gesammelte Material. Erst Jahre später „begegnete“ er seiner Uhrenvision – in Form eines Manometers, eines Instruments, das den Druck misst. Die Legende sagt, dass die Erleuchtung beim Anblick eines Blutdruckmessgeräts kam. Manometer gibt es aber beispielsweise auch – und wieder schliesst sich ein Kreis – bei Kaffeemaschinen.
Der Manometro (Bild oben) war in der Folge bald geboren. Mit ihrem unverwechselbar reduzierten Gehäuse und dem klar gestalteten sehr gut ablesbaren Zifferblatt fand die Uhr bei Italiens Prominenz auf Anhieb eine exklusive Fangemeinde, man riss sich förmlich um das begehrte Teil. Agnelli-Erbe und Lebemann Lapo Elkann trägt eine, der Modedesigner Roberto Cavalli, der Fussballer Roberto Biaggi. Der Kult war lanciert. Während der Arbeiten an seinem Uhrenprojekt entdeckte Mazzuoli übrigens, dass einer seiner Vorfahren ein Turmuhrenbauer war – so kann sich der smarte Designer sogar rühmen, eine Familientradition weiterzuführen. Und dies nicht etwa im Jura, sondern eben in der Toskana.
Made in Italy
Die Uhr wird in Italien gefertigt (in der Toskana, präzisiert der Vollblut-Toskaner Mazzuoli), beim Werk allerdings greift man auf bewährte und zuverlässige Mechanik aus dem Schweizer Haus ETA zurück. Zum Einsatz kommt das automatische ETA 2824-2 in seiner gepflegten Ausführung. Das stattliche Gehäuse mit einem Durchmesser von 45 mm und einer Höhe von knapp 15 mm wird von Hand gefertigt und besteht aus gebürstetem oder poliertem Edelstahl. Speziell ist die Anordnung der Krone – meist ist diese bei Uhren im rechten Winkel zum Band angebracht, beim Manometro ist sie entweder bei 2 oder aber – für „Rechtsträger“ bei 10 Uhr angebracht. Die Zifferblätter gibt es in den Farben schwarz, weiss, elfenbein oder blau.
Der Erfolg verlieh Mazzuoli Flügel und inspirierte ihn weiter. 2007 wurde der Manometro um einen Chronographen ergänzt, in einem beinahe identisch aussehenden Gehäuse, mit elegant und clever integrierten, fast versenkten Drückern für die Stoppuhrfunktionen. Von „normalen“ Chronographen unterscheidet sich der von Mazzuoli auch noch durch die asymmetrisch angeordneten Hilfzifferblätter.
Auch bei den Gehäusen kreierte er Variationen: Der Manometro S (S für Sport) ist in einer limitierten Serie mit einem vollständig aus Carbon gefertigten Gehäuse und einer Titankrone erhältlich. High Tech pur.
Der Tourenzähler
Aus dem Hintergrund als ehemaliger Hobby-Rennfahrer wurde das nächste Modell lanciert. Mazzuoli fuhr in den siebziger Jahren mit den legendären Alfa Romeo GTA auf Rennkursen um die Wette – neben den Konkurrenten gab es da vor allem den Tourenzähler im Auge zu behalten. Und eben dieser Tourenzähler, der „Contagiri“ stand Pate für die Uhr dieses Namens. Der Designer nennt übrigens auch eine hübsche Sammlung von mehreren alten Alfas sein eigen. Die Krone fehlt vollends – aufgezogen und eingestellt wird die Uhr über die markante Lunette, die vorher entriegelt werden muss.

Supernova: Finnisches Meisterstück
12.09.2007Der junge Finne Stepan Sarpaneva (wir stellten ihn in „Tick different“ vor) geht unbeirrt seinen eigenen Weg. Mit der Supernova legt er nun ein Modell vor, das in Sachen Metallverarbeitung seinesgeleichen sucht.
Das Gehäuse ist ein Meisterstück, auf Höchstglanz polierte Elemente kontrastieren mit gebürsteten Oberflächen. Die Form des Gehäuses geht auf die Vorgängermodelle Loiste und das aus einem Harley-Davidson-Zahnrad gefertigte Einzelstück „Time Tramp“ zurück.
Das Zifferblatt, beziehungsweise was davon übrig bleibt, gibt Einblick in die Mechanik. Das „Skelett“ wird in verschiedenen Oberflächen gefertigt, unter anderem auch rotvergoldet. Was bei der 12-Uhr-Position wie eine „8“ aussieht, ist das Fenster für die von Sarpaneva bereits für die Loiste konstruierte Anzeige der Mondphase.
Der radikale Entwurf wird in einer Kleinstserie von lediglich 10 Exemplaren gebaut – dank unserer engen Zusammenarbeit mit dem schrägen Meisteruhrmacher konnten wir uns eine davon sichern. Die Bilder (fotografiert von Harry Tan – danke!) zeigen einen Prototypen – Stepan Sarpaneva war so nett, sie „Tick different“ vorab zur Verfügung zu stellen.

Glycine Coral Diver: die limitierte Taucheruhr von Uhrsachen
13.02.2007Uhrsachen sorgte 2006 für Aufsehen mit einer limitierten Serie einer Einzeigeruhr. Nun folgt der nächste Streich: Eine Taucheruhr, realisiert zusammen mit der Bieler Uhrenfirma Glycine.
Die Uhrsachen-Hausfarben schwarz und orange dominieren das Design der beiden Varianten des Coral Diver. Die bis 200 Meter wasserdichte Uhr kommt aus der legendären Combat-Linie von Glycine, bekannt für robuste Uhren mit einem exzellenten Preis-Leistungsverhältnis.
Das Gehäuse der Coral Diver ist aus Edelstahl, das Glas aus kratzfestem Saphir. Die grosse, griffige Krone ist verschraubt und wird seitlich durch einen ins Gehäuse integrierten Flankenschutz eingerahmt, so dass bei einem versehentlichen Stoss die Krone keinen Schaden nimmt.
Im Innern der Uhr tickt das äusserst bewährte ETA-Automatikwerk des Typs 2824-2, sichtbar durch einen Glasboden. Die Lunette ist, wie bei Taucheruhren vorgeschrieben, nur im Gegenuhrzeigersinn drehbar. Grosser Wert wurde beim Design des Zifferblatts auf die Ablesbarkeit gelegt. Die Farbkombination sorgt für hohen Kontrast, und die Elemente wurden aufs Wesentlichste reduziert. Die limitierte Serie kommt in zwei Varianten von je 50 Exemplaren in den Verkauf: Die eine Variante, der Coral Diver Black, hat ein schwarzes Zifferblatt mit sehr gut sichtbaren Leuchtindexen. Auch die Zeiger sind orange und mit Leuchtmasse ausgestattet.
Die zweite Variante, der Coral Diver Orange, hat ein oranges Zifferblatt, das vollkommen mit Superluminova belegt ist. Dadurch leuchtet in der Dunkelheit (also auch ab einer gewissen Tauchtiefe) das ganze Zifferblatt. Die schwarzen Zeiger sind ebenfalls mit Superluminova C3 beschichtet, dem stärksten erhältlichen Leuchtstoff.
Der Coral Diver wird in einem knallig orangen orignalen Pelicase geliefert, dem legendären, wasserdichten und fast unzerstörbaren Koffer aus extrahartem Kunststoff. Zu jeder Uhr gibt es im Set ein zweites Band aus Kautschuk sowie ein professionelles Bandwechselwerkzeug.
Chronometerzertifiziert: Die Coral Twins
Die Nummern 1-10 werden als Coral Twins im exklusiven Sammlerset angeboten. Sie sind zusätzlich von der offiziellen Chronometerprüfstelle C.O.S.C (Controle Officiel Suisse de Chronomètres) zertifiziert. Dies bedeutet, dass die in einer speziellen Ausführung gelieferten Werke („éxecution soignée“ mit speziellen Zahnrädern, rhodinierten und perlierten Oberflächen und personalisiert graviertem Rotor) durch ein streng normiertes Prüfverfahren gegangen sind und die Bezeichnung Chronometer tragen dürfen, die für höchst mögliche erzielbare Genauigkeit bei mechanischen Uhren steht. Auf dem Zifferblatt wird auf diese Zertifizierung diskret mit der Abkürzung C.O.S.C. hingewiesen.

Ulysse Nardin: Manufakturkaliber zum 160. Jubiläum
21.11.2006Anniversary 160 – das Jubiläumsmodell von Ulysse Nardin mit neuem Manufakturkaliber
Zum 160. Geburtstag lanciert Ulysse Nardin einen besonderen Leckerbissen: eine limitierte Serie mit den ersten Exemplaren des neuen Caliber 160 mit der Dual Ulysse-Hemmung.
Klicken Sie hier für eine ausführliche Bildergalerie.
Die Dual Ulysse Hemmung geht auf die Entwicklungsarbeit von Ludwig Oechslin zurück. Erstmals wurde sie im bereits legendären „Freak 28’800 V/h“ eingeführt. Es hat einen enormen Vorteil gegenüber allen anderen Kalibern: dieses mikromechanische Wunderwerk benötigt keine Schmierung und eliminiert die Gleitreibung, die Achillesferse der herkömmlichen Schweizer Ankerhemmung.
Die beiden Antriebsräder der Dual Ulysse Hemmung haben 18 aktive Zähne. Dies verbessert den Energiefluss merklich. Sie braucht nicht geölt zu werden. Die Übermittlung und Bewegung haben die gleiche Richtung, abwechslungsweise im Uhrzeigersinn mit dem ersten und im Gegenuhrzeigersinn mit dem zweiten Rad.
Die dem Wechsler gegebenen Impulse werden an die Unruh weitergeleitet. Der Wechsler ist ein Trieb, das sich abwechslungsweise hin- und herbewegt.
Das innovative Prinzip der Dual Ulysse Hemmung erlaubt eine merkliche Verminderung des Hebewinkels auf ungefähr 30 Grad, im Vergleich zu den 50-52 Grad auf ursprünglichen Ankerhemmungen. Der Hebewinkel entspricht dem durchlaufenen Unruhbogen zwischen dem ersten und dem letzten Kontakt der Hemmung. Je kürzer der Durchlaufbogen ist, umso kleiner ist der Einfluss auf die natürliche Schwingung der Unruh.
Neue Materialien
Caliber 160 verwendet Hemmungsräder aus Nickel-Phosphor. Da der Mechanismus, anders als die herkömmliche Ankerhemmung, mit zwei Hemmungsrädern ausgestattet ist, muss die Masse dieser Räder stark reduziert werden, um die erlangten Vorteile nicht durch erhöhten Energiebedarf zunichte zu machen. Um dies zu realisieren, hat Ulysse Nardin sich der LIGA-Technologie zugewandt, einem speziellen Verfahren, das Photolithographie und Galvanoplastie miteinander kombiniert, um diese Räder förmlich nach den photolithographisch hergestellten Ätzvorlagen wachsen zu lassen.
Das Resultat sind Räder mit unglaublich komplexen Konturen, einschliesslich ausgehöhlter Zähne. Mit diesem Herstellungsverfahren ist es möglich, selbst aus einem Material wie Nickel, das nicht gerade leicht ist, extrem leichtgewichtige Komponenten herzustellen. Während nämlich Nickel-Phosphor mit 9 Gramm pro Kubikzentimeter, gegenüber Stahl mit 7,8 Gramm pro Kubikzentimeter vergleichsweise schwer ist, erlaubt die dank LIGA-Technologie erzielte radikale Skelettierung beinahe gewichtslose Hemmungsräder für das Caliber 160.
Chronometerwerk mit Prüfzertifikat C.O.S.C.
Als Beweis für das tiefe Vertrauen, das Ulysse Nardin dem neuen Uhrwerk entgegen bringt, trägt jedes Caliber 160 ein Chronometerzertifikat vom COSC.
Obschon mit einer Stosssicherung ausgerüstet, wird die Unruh durch eine durchgehende Brücke, die an zwei Punkten auf die Platine des Caliber 160 geschraubt ist, in ihrer Position gehalten. Diese Konfiguration garantiert noch grössere Sicherheit und Stabilität für das gesamte Regulierorgan, sogar wenn die Uhr einem gröberen Stoss ausgesetzt ist.
Apropos Regulierorgan: wenn man die Krone zieht und dadurch der Sekundenzeiger gestoppt wird, kann man durch das gewölbte Saphirglas auf der Rückseite der Uhr die elegante Unruh betrachten, die ebenfalls vollständig bei Ulysse Nardin gefertigt wird. Sie wird ohne Rücker über vier im Unruhreif versenkte Masseschrauben reguliert, welche dadurch keine Turbulenzen erzeugen, wenn die Unruh mit ihren 4 Hertz schwingt.
Ulysse Nardin legt Wert darauf, zu betonen, dass, abgesehen von der Spiralfeder, alle übrigen Komponenten der Unruh ebenfalls in der Manufaktur gefertigt werden.
Die technischen Daten des bahnbrechenden Calibers 160 sind beeindruckend. Das Uhrwerk verfügt über eine eindrückliche Gangautonomie von 50 Stunden, die in einem einzigen Federhaus gespeichert ist. Ähnlich wie die Manufaktur Reibung aus ihrer Hemmung verbannt hat, hält sie sie auch aus dem Kugellager des Aufzugsrotors fern, indem sie auf Keramikkugeln setzt.
Anniversary 160 – Limitierte Auflage
Anniversary 160 ist ein passender Meilenstein für den 160. Geburtstag der Manufaktur Ulysse Nardin. Ihr Augenmerk auf Innovation und Funktion, gepaart mit Kreativität, repräsentiert die Werte, welche Ulysse Nardin ausmachen. Sie bilden die Brücke zwischen der Vergangenheit und dem, was sich nun als eine weite, grenzenlose Zukunft präsentiert.
Anniversary 160 – die Uhr zum 160-jährigen Jubiläum der Manufaktur, die mit den ersten Exemplaren des neuen Caliber 160 ausgestattet ist, wird im Jahr 2006 in zwei Serien zu 500 Uhren lanciert werden.

Tangomat: Das Manufakturwerk aus Sachsen
27.10.2006Die deutsche Marke Nomos ist seit vielen Jahren ein sicherer Wert – auch im Sortiment von Uhrsachen. Bereits letztes Jahr präsentierten die findigen und originellen Sachsen ihr erstes richtiges Manufakturwerk. Es wurde komplett von Nomos entwickelt und überraschte die Fachwelt mit einigen Neuerungen.
NOMOS Glashütte darf sich jetzt Manufaktur nennen. Der jüngste der Glashütter Uhrenhersteller hat seine erste Automatikuhr auf den Markt gebracht, das Modell Tangomat. Das Werk: komplett bei NOMOS Glashütte entwickelt und vor Ort produziert. Für das Unternehmen bedeutet dies den Einstieg in die kleine Gruppe von Unternehmen, die wirklich in der Lage ist, eigene Kaliber zu bauen.Innerhalb nur gut eines Jahres hat der 30jährige Uhrmacher Mirko Heyne diesen „Meilenstein“ konstruiert und entwickelt. Nicht eingerechnet die Testphase, die im August 2005 begann: 250 Tangomaten, 125 mit, 125 ohne Datum, wurden von da an drei Monate lang von Interessenten den Alltagsstrapazen unterzogen und auf den Kopf gestellt, bevor die Testergebnisse die Uhr endgültig marktreif machten.
Besonders beim Automatikwerk von NOMOS: Der Zentralrotor ist aus Schwermetall und aus einem Stück. Sein Radius ist grösser als üblich, und auch deshalb ist die Aufzugsleistung des NOMOS-Automaten sehr gut. Der Tangomat ist sehr übersichtlich gebaut und dürfte von seiner robusten Konstruktion her sehr zuverlässig sein.Die kleine Sekunde, bekannt von den bisherigen Modellen mit Handaufzug, bleibt auch beim NOMOS-Automaten. Vorteil: Sie ist besser lesbar als eine zentral angebrachte Sekunde. Ausserdem wird durch sie die Uhr flacher, weil sich so im Zentrum der Uhr nicht drei Zeiger übereinander stapeln. Auch den Boden aus Saphirglas kennt man von NOMOS schon. Er ist bei der neuen Uhr besonders wichtig. Man sieht nicht nur, wie es tickt und wippt, sondern auch die NOMOS-Konstruktion mit dem schönen Namen Wippebewegungsgleichrichter und das Doppelrad mit Freilaufkupplung. Im Federhaus sorgt eine Rutschkupplung dafür, dass die Zugfeder bei Vollaufzug nicht blockiert. Der Rotor ist mit seinem Gewicht sehr genau auf die Zugfeder abgestimmt. So verlangsamt sich der Rotor, wenn die Feder voll gespannt ist, die Rutschkupplung wird seltener ausgelöst und somit geschont.Und natürlich sind da noch die ortstypischen Merkmale einer Glashütter Manufaktur: Glashütter Dreiviertelplatine, Glashütter Gesperr, Triovis-Feinregulierung, Sonnenschliff auf Sperr- und Doppelrad, Langeleist-Perlage, Glashütter Streifenschliff, temperaturgebläute Flachkopfschrauben – alles da.Das von NOMOS entwickelte Automatik-Kaliber ist ein grosses Werk: Sein Durchmesser beträgt 31 Millimeter. Die Unruh ist wesentlich grösser als die vieler vergleichbarer Kaliber. Grosses Werk gleich grosse Ganggenauigkeit, lautet die Regel. Und die Ganggenauigkeit bereits des Prototypen lag unter einer Minute Abweichung pro Woche. Die Höhe des neuen Werkes bleibt mit 4,3 Millimetern dennoch NOMOS-gering – so ist das Höhen-Weiten-Verhältnis des Automaten besonders günstig und die neuen Uhren mit diesem Werk behalten ihre günstigen Proportionen.